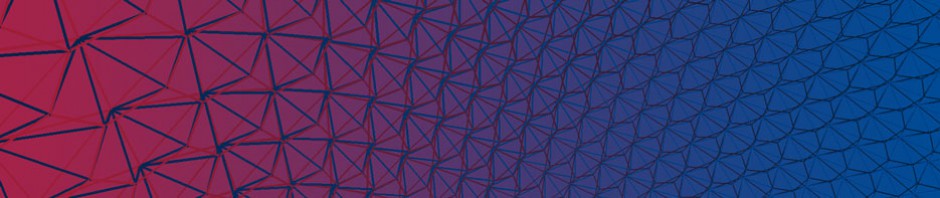Klaus Klaasen hilft mir, den Himmelsprojektor im oberen Teil der Hyperborea einzubauen.
„Warum hast du es nicht patentieren lassen?“
„Ich wollte es für mich haben. Stell dir vor, Saudi-Arabien hätte es gewusst, die hätten den ganzen Himmel mit Koranversen bedeckt. Oder politische Propaganda: Von Nordkorea kann man Parolen in den Himmel senden, die man von Seoul aus sehen kann. Oder denk an die USA am Golf, an die Israelis gegen Gaza, oder, sofern die Staaten es erlauben, vermutlich gegen Zahlung einer Gebühr oder Steuer, an Himmelswerbung! Manch ein reicher Schnösel hätte es sich wohl nicht nehmen lassen, den Himmel mit Graffitis zuzukleistern! Nee, dafür wollte ich nicht verantwortlich sein. Obendrein schätze ich die Arbeit der Astronomen zu hoch ein, um diese Art der Lichtverschmutzung zu fördern.“
„Wenn du es nicht nötig hattest…! Aber schade ist es doch, man hätte damit allerhand anstellen können.“
„Hinzu kommt, dass die Vereinigten Staaten mein Himmelsprojektor vermutlich als Waffe eingestuft hätten, um sie anschließend zu verbieten.“
„Eine Propagandawaffe, meinst du?“
„Vermutlich auch, aber in erster Linie denke ich an ihre Spionagesatelliten. Schon Anfang der Nulljahre hat das sogenannte Weltraumkommando der amerikanischen Luftwaffe den Betrieb ihrer eigenen Teleskope auf Hawaii und auf dem Festland,i die mit adaptiver Optik operierten, massiv eingeschränkt, weil die künstlichen Leitsterne angeblich die Satelliten blenden könnten. Sie haben die Betreiber gezwungen, die Anlagen auszuschalten, wenn ein Satellit in ihrer Nähe flog, zuweilen bereits dann, wenn der Satellit noch nicht über dem Horizont aufgetaucht war, und die Astronomen sollten jede geplante Inbetriebnahme eines künstlichen Leitsterns vier Tage im Voraus anmelden und genehmigen lassen. In der Folge haben sie diese Regeln zusätzlich auf die von Amerika betriebenen Großteleskope in Chile ausgeweitet und sie haben Druck ausgeübt, damit die anderen Länder, die ebenfalls Leitsterne eingesetzt haben, sich nach ihren Regeln richteten, wogegen die sich verständlicherweise gewehrt haben.ii Speziell die Russen und die Chinesen haben sich einen feuchten Kehricht darum geschert, wenn sie nicht gestorben wären, würden sie heute noch darüber lachen!“
„Typisch für die militärische Denkweise; ich verstehe, was du meinst und was dich daran stört. Hast du den Projektor jemals eingesetzt und sei es heimlich?“
„Nicht wirklich. Selbst die Funktionstests habe ich lediglich mit kleinen einfachen Mustern ausprobiert: Kreuze, Kreise und so, die durch den Himmel tanzten. Ich bin für manch eine UFO-Sichtung verantwortlich! Eines Tages habe ich mir den Spaß erlaubt, die Enterprise aus der Serie Star Trek in den Himmel zu projizieren, sie flog richtig flott und war natürlich auf keinem Radarschirm zu sehen! Manöver hat die Enterprise hingekriegt, das glaubst du gar nicht!“
„Also du meinst, dass es funktioniert?“
„Klar! Das ist wie die Lasershows bei den Konzerten meiner Jugend. Ein winziger, schnell rotierender Spiegel, dazu die Steuerelektronik für die Laserpulse, kinderleicht!“
Die Laserkanone war schon mächtig, 20.000 Watt Nennleistung, aber recht kompakt. Kaum 25 Kilogramm, davon mindestens zehn Kilogramm einschließlich eines recht lauten Lüfters für die Kühlung während des Betriebs. Leider war der Stromverbrauch recht hoch, der Wirkungsgrad erreichte keine 30 Prozent. Wir bauten die Geräte ein, verbanden sie mit dem Rechner, justierten den Spiegel und die Laserkanone und bedeckten die optischen Teile, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen. Anschließend machten wir uns auf den Weg nach unten durch die enge steile Wendeltreppe, die die obere Kanzel mit der Gondel durch die Mitte der Hyperborea verband. Auf diesem Weg konnten wir das Innere der Luftjacht durch Luken sehen, die den Abstieg milchig erhellten. Die Treppe selbst war aus Gitterkohlenstoff, man konnte den ganzen Schacht nach oben und durch die Füße nach unten sehen. Ich wusste zwar, dass die Gitter fest genug waren, aber mir gefiel dieser Abstieg nicht. Auf dem Weg nach oben merkt man es nicht, aber abwärts schaut man eher hinunter und das löst bei mir Höhenangst aus. Es mag sich merkwürdig anhören: Ich, der Luftschiffe baut und liebt, ausgerechnet mir wird schwindlig, wenn ich eine enge Treppe hinuntersteige, nur weil man durch die Füße – schlecht beleuchtet – bis in fünfzig Meter Tiefe sehen kann. So ist es aber und es ist widerlich. Die Lampen mussten wir den ganzen Weg nach oben noch anbringen und verbinden, merkte ich mir vor, ansonsten würde man nachts eine Taschenlampe brauchen.
Unten endet die Treppe am Eingang des Werkzeugraums hinter der Lindemaschine zur Luftverflüssigung und den Behältern für die flüssige Luft, dem flüssigen Sauerstoff und dem flüssigen Stickstoff. Dazwischen befindet sich unser Generator, von einem Stirlingmotor angetrieben, um die Prozesswärme, die bei der Luftverflüssigung entstand, zu nutzen. Ein weiteres Stockwerk tiefer ging es in die Vorratsräume, die unten mittig angebracht waren. Die Kühlräume kühlen wir mit der Kälte, die aus den Tanks mit den verflüssigten Gasen entweicht. Wir erzeugten eine Kühlkaskade, mit einer von Raum zu Raum höheren Temperatur: Der Raum direkt unter den Tanks ist auf -25 °C gekühlt. Die hier entweichende Kälte nutzen wir, um den daneben liegenden Raum auf -7 °C zu kühlen, dessen Kälte wiederum für den nächsten Raum, der auf knapp über 0 °C gekühlt wird, zuletzt nutzten wir die Restkälte, um den Raum für die frischen Lebensmittel auf 5 °C zu kühlen. Diese gekühlte Luft nutzen wir dann desweiteren mit einem Wärmetauscher zur Vorkühlung der Außenluft, die in die Lindemaschine gespeist wird. Damit bleibt der Prozess in Gang, alles sehr elegant und technisch effizient. Der kälteste Lagerraum für Lebensmittel und der wärmste sind je 15 Quadratmeter groß und 2,5 Meter hoch, die beiden anderen jeweils nur 5 Quadratmeter. Leider waren zu Beginn unserer Reise diese Räume alle sehr leer – bis auf das Bier im 5 °C Raum, zum Glück! –, darum mussten wir uns bald kümmern. Im oberen Stockwerk neben der Lindemaschine befinden sich die Wassertanks. Unten steht der Behälter für das gebrauchte Wasser, das wir als Ballast benutzten, mit großen fernsteuerbaren Abflüssen direkt nach unten, um im Notfall schnell Gewicht loswerden zu können. Auch dieser Behälter war ziemlich leer, wir hatten zu Beginn Sandsäcke als Ballast. Die konnte man nicht so schnell und automatisch abwerfen, das würde man notfalls per Handarbeit erledigen müssen, sofern man in einer Notsituation, die es erforderte, Ballast abzuwerfen, die Zeit dazu haben sollte. Die Hyperborea war nach wie vor mitnichten fertig.
Wir gingen aber nicht nach unten in die Kühlräume und nicht in die Kryoräume mit den Flüssiggastanks, die man nur mit Schutzanzügen betreten sollte (zwei Stück, rechts im verschlossenen Spind, mit Atemmasken), sondern wir gingen an Maschinenraum und Küche vorbei in die Essräume. Diese stellten den ursprünglich für die Gäste der Hyperborea bestimmten Bereich dar, wo der Luxus begann und in dem von der Arbeit, die in diesem Schiff im Hintergrund zu verrichten ist, nichts mehr zu spüren sein sollte. Ganz gelungen ist uns das leider noch nicht, das ganze Schiff wurde eher genutzt als genossen, überall lagen Werkzeuge, Kisten, Schachteln, offene Kabel und Teile herum. Dort trafen wir auf meine geliebte Frau und Ali. Herr Augsburger, Beata Maloumie, Nicco und Sven Maven verlegten an verschiedenen Stellen des Luftschiffes die letzten Stromkabel, montierten letzte Schalter und Sensoren oder verbanden die letzten Zu- und Abwasserleitungen der einzelnen Schlafkabinen.
„Habt ihr es einbauen können?“, fragte meine geliebte Frau.
„Ja, heute Abend können wir es ausprobieren.“
„Wie wäre es, wenn wir uns bis dahin uns etwas kochen?“, schlug Klaas Klaasen vor.
„Gern!“ antwortete meine geliebte Frau. „Pardel und Ali helfen sicher mit, nicht wahr?“
Ich würde nicht nur gern etwas zur Entspannung kochen, sondern auch etwas Gutes essen. Leider sind unsere Vorräte überschaubar, Beata Nalga Maloumie und Sven Maven haben sich nicht getraut, Menschen aufzusuchen und haben entsprechend wenig Proviant mitgebracht. Zum Glück mangelt es uns nicht an Trinkwasser. Das Bier reicht mindestens zwei Monate. Alles andere ist nach wie vor prekär. Mit Ausnahme der Energie, sie erneuert sich schneller, als wir sie verbrauchen. Immerhin.