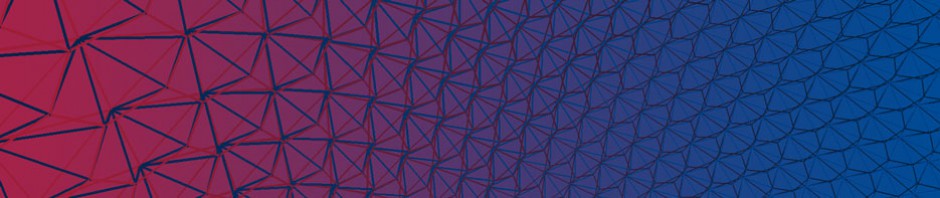On tue un homme, on est un assassin.
On tue des millions d’hommes,
on est un conquérant.
On les tue tous, on est un dieu.i
Jean Rostand
(Pensées d’un biologiste)
Der Kivu-See an der Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo explodierte förmlich und stieß eine unvorstellbar große Menge CO2, Methan und Schwefelwasserstoff in die Atmosphäre aus: Die Abflüsse des Sees wurden zum Abfluss für eine CO2- und Methan-Überflutung, falls man dieses Phänomen so nennen darf, eigentlich handelt es sich eher um eine Übergasung. Die vielen vor Ort fliegenden Augen wurden durch die höhere Dichte des CO2 und des Methans über 500 Meter in die Höhe geschleudert und kamen einfach gegen diesen geisterhaft gesteigerten Auftrieb nicht an. Die unsichtbare Grenze der tödlichen Wolke war kaum zu überwinden. Das vermittelt eine Ahnung von dem Volumen des freigesetzten Gases. Wenn eine Gaslawine 500 Meter hoch ist und weit mehr als die Fläche des 2.650 km2 großen Sees bedeckt, ist die darin enthaltene Menge an Gas enorm. Der See sprudelte nach wie vor wie eine geschüttelte Flasche Champagner. Die Teleobjektive gaben trotz der Höhe ein sehr detailliertes Bild ab, CO2 und Methan sind durchsichtig. Warnung wurde ausgerufen, aber es gab nur Panik, kein Entkommen. Das Gas war überall, jedoch nirgends zu sehen. Zu riechen gab es nur den Fäulnisgestank des Schwefelwasserstoffs. Menschen und Tiere fielen um und standen nicht mehr auf. Die Augen kamen lange Zeit nicht gegen die dichtere Luft an und konnten somit nicht absinken. Für die Menschen gab es keine rettenden Erhöhungen, die sie rechtzeitig erreichen konnten. Sogar die Pflanzen erstickten, was man erst nach einigen Tagen bemerkte. Zunächst wurden sie gelb, dann braun. Viele Vögel – vermutlich durch den Gestank des Schwefelwasserstoffs aufgeschreckt, vielleicht auch von der anfänglichen Kälte des Gases – retteten sich, vorausgesetzt, sie konnten hoch und weit genug fliegen. Das Gas aus der Tiefe des Sees war nicht nur aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung dichter als normale Luft, sondern ebenfalls wegen seiner geringeren Temperatur. Das tiefe Wasser des Sees ist kälter als tropische Luft, hinzu kommt, dass sich das Gas beim Aufsteigen aus der Tiefe ausdehnt und sich ausdehnende Gase kühlen zusätzlich ab. Es war ein schöner, sonniger, windstiller Tag. Die Gaswolke türmte sich in die Höhe auf, blieb gleichzeitig am Boden kleben und kroch von der Schwerkraft getrieben in alle Nachbartäler auf der Suche nach einem Abfluss. Wenn die Vögel in der Luft vom Gas eingeholt wurden, fielen sie im Flug in Ohnmacht und trudelten zu Boden. Die Grenze der tödlichen, am Fluss entlangkriechenden Wolke konnte, von der sicheren Warte der Augen aus gesehen, an den fliehenden Vögeln erahnt werden.
Aber warum gab es am Kivu-See so viele Augen schon vor dem Ausbruch? Wer hatte sie eingesetzt? Unsere Daten zeigten, dass die Bestellungen koordiniert aus China, der Schweiz und den USA gekommen waren, das hätte uns auffallen sollen. Die spätere Auswertung der Bilder zeigte, dass der CO2-Ausbruch durch mehrere Detonationen in der Tiefe des Sees genau über den Stellen verursacht wurde, an denen zwanzig Minuten vor Beginn der Katastrophe jeweils eine große Barkasse versenkt worden war. Jemand hatte mehrere mächtige Wasserbomben am Grunde des Sees gezündet und sich Augen für die Dokumentation bestellt. Die Erschütterung hatte CO2 und Methan in den tiefen Schichten des Sees freigesetzt und damit eine Kettenreaktion verursacht. Das Gas stieg perlend an die Oberfläche des bis zu 450 Meter tiefen Sees und beförderte die gasgesättigten Schichten des Sees mit an die Oberfläche, wo sie aufgrund des niedrigeren Drucks noch mehr Gas freisetzten. Es entstand ein Kreislauf: Die unteren Schichten wurden nach oben gerissen, setzten bei abnehmenden Druck nach und nach das gelöste Gas frei, womit noch mehr Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche befördert wurde, was wiederum noch mehr Gas freisetzte – in einer sich selbst verstärkenden Zirkulation. Je höher der Druck, desto wasserlöslicher ist CO2 – und umgekehrt. Jedenfalls war uns klar, dass die Gasentladung mit Absicht hervorgerufen worden war. Millionen Anwohner des Sees und unzählige Tiere hatten keine Chance. Entlang des Ruzizi-Flussbetts, dem natürlichen Abfluss des Kivu-Sees, reichten die tödlichen Folgen des Ausbruches bis zum Tanganjika-See. Die Bewohner Gisenyis, Kibuyes, Cyangugus in Ruanda und die Bewohner Bukavus, Kabares, Kalehes, Sakes und Gomas in der sogenannten Demokratischen Republik Kongo, um nur die größten Ansiedlungen zu nennen, erstickten alle. Ebenso betroffen waren die Bewohner der Flüchtlingslager auf beiden Seiten der Grenzen, die Militärposten und Lager der kongolesischen und der ruandischen Armee sowie die dort stationierten Blauhelme der Vereinten Nationen. Allein unmittelbar am Becken des Sees lebten über drei Millionen Menschen. Entlang der knapp über 100 Kilometer, innerhalb derer der Ruzizi die über 600 Meter Höhenunterschied zwischen dem Kivu-See und dem Tanganjika-See überwindet, lebten weitere zwei Millionen. Auch sie mussten sterben. Die Staudämme entlang des Flusses stellten keine Barriere für das Gas dar, es blieb dort nur länger hängen, nachdem die große Wolke schon abgezogen war, was einige Tage dauerte. Die Folgen waren noch am Westufer des Tanganjika-Sees – es herrschte an diesem Tag en leichter Ostwind – an vielen Stellen tödlich. Die Gaswolke nahm vom Tanganjika-See aus die Route, die Herny Morton Stanley 1876 genommen hatte, als er im Auftrag des belgischen Mörderkönigs Leopold II den Kongo in Beschlag nahm: Von Kalemie (bis 1966 Albertville/Albertstad, nach dem belgischen König Albert I.) 350 Kilometer entlang des saisonal ausgetrockneten Flussbetts des Lukuga – der einzige Abfluss des Tanganjika-Sees – durch die Zentralafrikanische Schwelle bis zum etwa 190 Meter tiefer fliesenden Lualaba, der im weiteren Flussverlauf ab den Boyomafällen bei Kisangani Kongo genannt wird.ii Erst nach vielen Tausend Kilometern im mittleren Flusslauf des Kongo hatten die meisten Menschen genügend Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, wofür die unzureichende Kommunikation maßgeblich verantwortlich war. Das Gas floss letztendlich immer verdünnter in den Atlantik, an Kinshasa und Brazzaville vorbei, sich an den engen Schluchten der Livingstone-Wasserfälle ein letztes Mal sammelnd, dort, wo der Kongo bis zum Meer nicht mehr schiffbar ist. Selbst in dieser Entfernung gab es Tote unter denen, die nicht hoch genug geflohen waren. Entlang des Tanganjika-Sees, des Lukuga und des Kongos schichteten sich die Gase laminar auf: CO2 ist schwerer als Methan, floss daher zuerst in die unteren Schichten in unmittelbarer Bodennähe, und verdrängte das Methan nach oben. Als Nachhut kroch Schwefelwasserstoff, giftig, ätzend und nach faulen Eiern stinkend, der unsichtbaren Verwüstung hinterher. Darüber blieb die normale Luft, in die sich in komplexen Verwirbelungen das Methan hochschraubte. Einmal geschichtet, floss das schwerere CO2 schneller bergab, das Methan blieb zurück und es kam erst in Bodennähe, nachdem das CO2 und der Schwefelwasserstoff vorbeigeströmt waren, um dann den schweren Gasen hinterherzufließen, ebenfalls unsichtbar, aber brennbar. Ein Funke genügte, um große Mengen Methan immer wieder zur Explosion zu bringen. Irrlichter entstehen ähnlich, allerdings war was im Kongo geschah eine ganz andere Größenordnung. In Senken, vor Staumauern, in Kellern blieb es noch lange explosionsgefährlich, bis sich das Methan schliesslich – leichter als Luft – in die Höhe verflüchtigte.
Hatten die Wasserbombenzünder das Ausmaß der Katastrophe geahnt? War eine derart mörderische Katastrophe ihre Absicht gewesen? Schwer zu sagen, wir erfuhren nicht, wer deren Verursacher gewesen ist, aber man verdächtigte öffentlich ARABIS. Es gab keine glaubhaften Bekennerschreiben, gleichwohl gab es Nachahmer: In den folgenden Tagen wurden Explosionen auf dem Grund des Manoun-Sees und des Nyos-Sees – beide liegen in Kamerun – registriert, die ebenfalls zu Gasentladungen führten. Glücklicherweise sind diese Seen sehr viel kleiner als der Kivu-See. Die Gasmenge war dementsprechend sehr viel geringer, bestand nur aus CO2, ohne Schwefelwasserstoff, war daher geruchsfrei und enthielt nur Spuren von Methan. Die Anzahl der Opfer hier hatte mehr mit der Panikreaktion nach Verbreiten der Nachricht als mit dem Gas selber zu tun. Die Anschläge waren trotzdem eine Sauerei. Im südbayrischen Alatsee nahe der österreichischen Grenze kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall, aber dieser See ist mit seinen zwölf Hektar Fläche so klein und die darin in einer lediglich drei Meter mächtigen Schicht enthaltene Menge Schwefelwasserstoff so gering, dass sich nicht sagen lässt, was diese Aktion bewirken sollte. Die Polizei ermittelte nur kurz, es waren hier wenigstens keine Toten und keine Verletzten zu verzeichnen. Vermutlich war es ein dummer Jungendstreich.
Die Millionen Toten am Kivu-See und an seinen Abfluss waren unmöglich dezent zu begraben. An manchen Stellen – unter anderem an engen Schluchten und Windungen der verschiedenen Flüsse, an den Staudämmen des Rizuzu, an den Buchten des Tanganjika-Sees und zuletzt an den Ufern des Malebo Pools – blieb das Gas mehrere Tage in lebensgefährlicher Konzentration in der Luft. Es gab kein Hinkommen dorthin, wo es zuvor kein Entkommen gegeben hatte. Langsam vertrockneten die Pflanzen, die Menschen und Tiere verfaulten. Einige Insekten überlebten, sie schafften es, mit weniger Sauerstoff am Leben zu bleiben, aber nur Insektenfresser, Aasfresser, Mistkäfer und die Arten, die totes Holz und tote Pflanzen fressen, hatten genug Nahrung. Schmetterlinge und deren Raupen schafften es nicht, vielleicht jedoch die verpuppten Larven. Mal sehen, welche Blüten sie vorfinden, wenn sie ausschlüpfen.
Nebenbei starben bei dieser Mordsaktion siebenunddreißig Berggorillas, aber die fielen mittlerweile nicht mehr ins Gewicht. Sie waren ohnehin dem Tode geweiht, ohne die geringste Chance auf die Verbreitung ihrer Gene.
zurück • vor