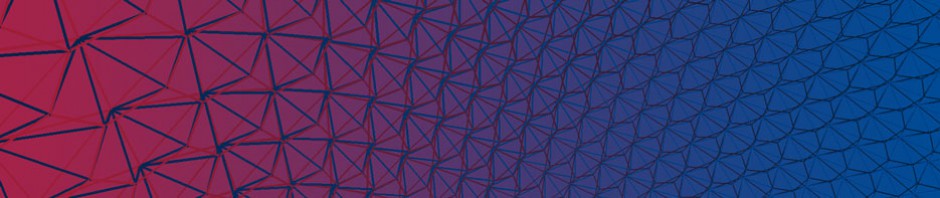Mitleid mit den Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, daß man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Tiere grausam ist, könne kein guter Mensch sein.
Schopenhauer
Grundlage der Moral, §19
Es kann sein, dass die Erklärung für die Katastrophe der Menschheit einfacher ist, als wir sie uns bisher ausgemalt haben: Nach einer gewalttätigen Initialzündung mit vielen Opfern – wie zunächst am Kivu-See geschehen, anschließend in Rom, schließlich immer schneller überall – leiden diese Opfer unter der Posttraumatischen Belastungsstörung, meist mit der Abkürzung PTSD bezeichnet, aus dem Englischen für Post-Traumatic Stress Disorder was eingedeutscht manchmal mit post-traumatische Belastungsstörung bzw. -reaktion wiedergegeben wird. Die Überlebenden zeigen als Folge des PTSD unvorhersehbares asoziales Verhalten, billige Gewaltausbrüche, Depressionen und anormale Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse.i PTSD verbreitet sich selbsterhaltend: Wenn es bei den Opfern zu einem Verhalten führt, wie es die ursprünglichen Täter bei ihnen ausgeübt haben, kommt es zu einer Kettenreaktion von traumatisierten Tätern, die alle früher Opfer waren. Diese Theorie ist keine Ausrede für die Täter, aber sie erklärt ihr Verhalten. Ein ähnliches Verhalten haben Delfine und Wale früher unter dem Jagddruck des Menschen gezeigt, wie ich meiner geliebten Frau erzähle. Es war für die Tiere stressig und traumatisch und dementsprechend zeigten sie, genau wie wir Menschen in solchen Situationen, alle gerade genannten Symptome.
„Du und deine Delfine! Delfine sind Vergewaltiger!” Meine geliebte Frau war gereizt.
„Vielleicht, weil die Weibchen keine Arme haben, um sich zu wehren.“ Mit solchen Witzchen würde ich bei meiner geliebten Frau keine Punkte sammeln. Es stimmt aber, dass männliche Delfine ohne eigene Bezugsgruppe sich manchmal zu zweit oder zu dritt zusammentaten, um Weibchen zu vergewaltigen. Einige Gruppen Delfine schlossen sich zu größeren Gruppen zusammen, um die Abwehr einer solchen Attacke besser organisieren zu können, oder aber, um selber eine Attacke durchzuführen und fremde Weibchen zu entführen.ii
„Natur ist Gewalt, ich will keine Ausreden, keine flachen Witze und keine falsche Idylle.“
„Der Mensch ist also natürlich.“ Noch ein schlechter Witz, die aggressive Reizbarkeit, mit der meine geliebte Frau auf das Thema PTSD reagierte, brachte mich aus dem Konzept.
„Gewesen, ja.“ Sie blieb trocken und kurz angebunden.
„Dabei bringt es den Delfinen keinen nennenswerten evolutionären Vorteil, nach diesen Attacken kommt es so gut wie nie zu einer Befruchtung“, sagte ich, als ob das ein Argument gewesen wäre. Dabei ging es doch gar nicht um die Delfine.
„Aber die Weibchen kriegen Angst und werden erniedrigt“, antwortete prompt meine geliebte Frau. „Da die Delfingesellschaft und die Delfinkultur matrilinear sind, werden Angst und Schrecken kulturell vererbt. Verhielt es sich bei uns Menschen nicht ebenso? Bis auf die Kleinigkeit, dass die Männchen bei uns gewonnen haben… Vielleicht bestand darin das Problem! Was für ein Sieg!“
„Wenn wir Männer gewonnen haben, weiß ich, wie wir es angestellt haben. Mit dem Feuer!“
„…das wir Frauen vermutlich erfunden haben.“
„Das macht die ganze Angelegenheit noch perfider. Aber vermutlich habt ihr Frauen das Feuer nicht erfunden, sondern nur gelernt, es am Leben zu erhalten.“
„Das Feuer hat die Gesellschaft verändert. Wir lernten kochen, ihr wurdet noch gewalttätiger. Selbst unter einem Matriarchat wäret ihr nicht anders gewesen.“ Wenn meine geliebte Frau in der Form verallgemeinerte, war keine vernünftige Diskussion zu führen. Sollte ich jetzt etwa anmerken, dass ich derjenige war, der bei uns für das Kochen zuständig war? Lieber klein beigeben:
„Vermutlich war die Aggressivität schon beim gemeinsamen Vorfahren, dem Schimpansen, in ähnlicher Form vorhanden.“
„Aber Feuer beherrschen wir doch erst seit 300.000 Jahren!“
„Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir haben mit dem Feuer den endgültigen Siegeszug angetreten.“
„Liebe deinen Hund, er ist besser als dein Nachbar! Waffen haben bereits ganz früh eine Rolle gespielt.“
„Ach, mein Cherubimchen! Feuer hat doch so viele Vorteile. Es beleuchtet und wärmt. Es ermöglicht das Kochen. Das Essen ist leichter zu verdauen…“
„…, was angeblich unsere Gehirnentwicklung erst ermöglicht hat. Selbiges Buch habe ich auch gelesen.“
„Ja, und es befreit uns von Parasiten. Sie werden beim Kochen abgetötet und das Fleisch wird nahrhafter; es ist das einzige Lebensmittel, bei dem Kochen dessen Nährwerte für den Menschen verbessert!“
„Das kann die Braukunst genauso. Lieber Bier oder Wein als verseuchtes Wasser. Und nicht nur Fleisch wird durch Kochen nahrhafter und verdaulicher: Stärke, Maniok, Kartoffeln und Artischocken sind ebenfalls erst gekocht genießbar.“
„Als Hobbykoch wage ich zu behaupten, dass diese Lebensmittel später kamen.“
„So oder so meine ich, dass wir weniger Fleisch essen sollten.“
„Das hätten wir schon viel früher machen sollen, als es die anderen noch gab. Jetzt ist es egal.“
„Koch’ doch, was du willst! Hauptsache, es ist nicht zu wenig.“
„Eben. Und sozial ist es außerdem. Sowohl das Kochen als auch das Brauen und Keltern. Und sogar das Destillieren ist sozial.“
„Alles Soziale ist ein Anachronismus. Aber bei dir schmeckt es. Immerhin.“ Das Kompliment war ein Friedensangebot, ich sollte es besser annehmen, sonst würden wir noch lange im Kreis diskutieren.
„Der Koch bedankt sich für die Blumen.“ Ich gehe also kochen, das stärkt den sozialen Frieden. Heute bereite ich Robbenfleisch zu, nach einem abgewandelten Inuitrezept. Robben sind an warmen, sonnigen Nachmittagen, und nur während solcher flogen wir, leicht zu jagen. Sie liegen herum – meistens in großen Gruppen, aber oft genüg isoliert – und sie schauen nicht nach oben. Ihr Fett ist ein passabler Ölersatz zum Kochen und Braten, roh wie zu Salat schmeckt es tranig. Das Fleisch ist annehmbar, wenn die Tiere jung sind. Die Katzen und Foc fressen es nicht besonders gern.
Die Inuit bildeten keine Ausnahme, sie waren gleichermaßen ausgestorben. Ihre Hunde gingen kurze Zeit später ebenfalls ein, denn sie konnten auf sich allein gestellt keine Vorräte für die kalten Winter anlegen. Rentiere überleben, als ob nichts wäre. Allein die verbleibenden Hunde stören sie eine Weile, langsam jedoch nimmt ihre Zahl auch südlich des Polarkreises ab. Im Sommer vermehren sich die Hunde fleißig, aber im Winter kommen die Rentiere besser durch. Sie sind sehr zahlreich und weit verbreitet. Die Rentiere in Sibirien schmecken im Herbst ausgezeichnet, die in Skandinavien sind herber im Geschmack. Die Samek haben früher die Augen benutzt, um ihre Herden zu beobachten, heute beobachten wir sie manchmal; aber sie leben nicht mehr so eng zusammen, ohne Aufsicht zerstreuen sie sich über weitere Gebiete als früher.
Unter den Hunden überleben Tassis in Zentralasien. Die sehen gut aus. 750 Millionen Menschen hatten sich Hunde gehalten, jeder Zehnte, nur bei Muslimen war es seltener der Fall. Es scheint, ihr Prophet mochte keine Hunde, und sie folgen dem, was er niederschrieb. In diesen Gegenden gab es des Öfteren Füchse, manche kamen mir winzig klein vor. Im Großen und Ganzen sah ich weniger Hunde, als ich erwartet hatte, und die, die ich sah, glichen oft australischen Dingos – wie ein nach unten gezogener Durchschnitt dessen, was die Hunde an Variabilität zu bieten hatten: das Fell zwischen Asche und mausgrau, mit bräunlichen Tönen, weder lang noch kurz, den Schwanz meist zwischen den Beinen. Foc knurrte manchmal, wenn wir eine Meute Hunde überflogen. Am Boden versuchte ich, sie zu meiden, im Notfall hatten sie sich immer mit ein paar Schüssen in die Luft verjagen lassen.
Viele Hunde wurden am Ende von ihren Besitzern umgebracht, das fand ich selbst im Nachhinein sehr traurig. Manche Tiere wehrten sich nicht einmal, ihre letzten Augenblicke müssen für sie sehr enttäuschend gewesen sein. Sie verstanden es sicher nicht, sie hätten ihren Herrchen so etwas niemals angetan. Wie konnten Menschen ihren Tieren so was antun? Etwas muss im Menschen sehr tief im Inneren zerbrochen sein, wenn er sogar seine Lieblingstiere umbringt. Selbst Bettler wussten, dass man mit einem Hundewelpen oder einem Katzenjungen viel erfolgreicher bettelt als ohne, erfolgreicher sogar als mit Kindern (von denen auch viele umgebracht wurden, ich will nichts beschönigen). Die Menschen lieben Tiere, insbesondere die eigenen. Und dann brachten sie sie um… Andere Hunde flohen und irrten seitdem neurotisch durch die menschenleere Welt. Bei Weitem nicht alle Hunde hatten ein enges oder gar gutes Verhältnis zu ihren Menschen. Diesen Hunden geht es heute, sofern sie überlebt haben, ein wenig besser als den anderen, die ihren Herrchen oder Frauchen nachtrauern. Oftmals schließen sich die herrenlosen Hunde zu Meuten zusammen, ihr Zusammenhalt ist lose, sie wechseln die Gruppe bei geringen Anlässen.
Als ich das letzte Mal, vor achtzehn Monaten, nachguckte, gab es die chilenischen Schäferhunde nach wie vor, sie sahen aus wie früher. Ich registrierte weiterhin Herden, sie waren allerdings bereits kleiner geworden. Es schien ihnen gut zu gehen, sie hatten sich indes noch nicht so weit vermehrt, wie ich es mir ausgemalt hatte. Ich sehe in dem, was den Hunden droht, eine große Parallele zu dem, was uns Menschen widerfahren ist. Wir waren zu intelligent, viel intelligenter als unsere Umwelt. Deswegen haben wir ihr zu viel genommen aus dem einfachen Grund, weil wir dazu in der Lage waren. Bis alles erschöpft war und wir somit auch. Wir waren zu viele, weil wir zu viele wurden, und wir wurden zu viele, weil wir es konnten; so kam es, dass wir eines Tages zu viel von allem nahmen. Man hat es kommen sehen, Mahner fehlten nicht, aber keiner konnte es stoppen. Wird der Zusammenbruch bei den chilenischen Hunden sich genauso schnell und abrupt einstellen wie bei uns? Und wenn ja, ab wann?
Zum Thema Kalender: Meine geliebte Frau sendet mir auf meinen iTempt™ die Geschichte, derzufolge im 19. Jahrhundert, als russische Einsiedler und religiöse Puristen, die mit ihren Familien der Welt entsagt hatten, vom Expeditionskorps des Zaren nach langem Aufenthalt in Sibirien wiederentdeckt wurden, diese oft zuerst das genaue Datum erfragt haben. Das war ihnen wichtig, weil sie befürchteten, sich in den langen dunklen Winternächten verzählt zu haben, manchmal waren sie zudem krank und bettlägerig gewesen, und sie wollten wissen, ob sie die orthodoxen Feiertage zum richtigen Zeitpunkt gefeiert hatten. Sie dachten, ihr Seelenheil hinge davon ab. Sie wollten die Ephemeriden, die der Almanach vorschrieb, feiern, wie sie fielen, ganz präzise. Es hätte auch nichts genutzt, wenn man ihnen gesagt hätte, dass Ephemeriden und Ephemer dieselbe Wurzel haben, was kein Zufall ist, und dass Almanach ein arabisches Wort ist, das auf die Leidenschaft mittelalterlicher Muslime für Astrologie zurückgeht. Sie wollten es dennoch ganz genau nehmen. Wir führen weiter unseren Kalender, dank der iTempts™ ganz automatisch, unabhängig von unserer Position, in aller Ruhe. Wir haben ohnehin keine Ephemeriden zu feiern. Einzig ein Datum ist für uns relevant.
Was macht man mit aller Zeit der Welt? Sie mit Geist totschlagen? Am Ende gewinnt doch die Zeit… Geist wird vermutlich allgemein überschätzt, meiner ganz sicher. Aber uns steht nicht alle Zeit der Welt zur Verfügung, selbst nach so viel Wechsel bleibt nie etwas, wie es scheint.
Eines Tages geschah etwas, worüber ich mich jetzt, Jahre später, im Nachhinein doch wundern muss: als ich im dritten Jahr nach dem Ende im wild sprießenden Unkraut auf den grünen Hügeln Englands geometrische Kreise und Linien sah. Meine geliebte Frau sah sie ebenfalls, sagte jedoch nichts. Wir flogen weiter. Als ich ein Auge zurück in das Gebiet schickte, um genauer nachzuschauen, war die Fläche abgebrannt, aber man ahnte noch die Muster in der Asche. Dann regnete es und man sah gar nichts mehr. Ich sah nie wieder etwas Ähnliches.
Ich glaube jetzt, dass in Kürze die Natur einen gewaltigen evolutionären Schub erfahren wird. Mein Glaube, meine Hoffnung, beruht darauf, dass der Mensch, nachdem er so viele Tierarten ausgerottet hat, einen mit fremder Flora und Fauna so stark durchsetzten Planeten hinterlässt und eine durch Bauten und Monokulturen, die als Barriere für viele Spezies fungieren werden, so stark zerteilte Landschaft kreiert hat, mit so vielen kleinen Nischen, dass sich viele Mikrohabitate bilden werden. Zuerst, schätze ich, werden sich viele neue kleinwüchsige Arten bilden. Einige von ihnen werden wachsen und leichter manch eine Barriere überspringen. Die vielen Gifte, die wir hinterlassen, werden mutagene Folgen haben mit entsprechender Sterblichkeitsrate, aber desgleichen mit entsprechender Variabilität. Das letzte Mal, als sich die Erde als Ganzes einer solchen Durchmischung von Spezies gegenübersah, war zu Zeiten Pangäas vor über 150 Millionen Jahren, als Tiere die ganze Welt durchstreifen konnten. Die Grenzen der verschiedenen Spezies bildeten damals die klimatischen Zonen, die Barriere bildete – im Gegensatz zu heute – nicht das Meer. Erst mit dem Auseinanderbrechen des einen großen Kontinents entstanden immer neue Nischen, in denen sich die Spezies voneinander trennen konnten. Diese Trennung existiert heute noch, aber wir haben die Karten neu gemischt, indem wir viele Tiere und Pflanzen, absichtlich oder aus Versehen, überall auf der Welt ausgesetzt haben.
Meine geliebte Frau sagt dazu:
„Du bist ein Optimist! Die Anzahl der Phylen hat bereits irreversibel abgenommen, selbst wenn die Anzahl der Spezies zunehmen sollte, kannst du nicht leugnen, dass wir Menschen den Planeten insgesamt labiler hinterlassen. An manchen Stellen vergiftet oder anderweitig gefährlich. Und Pangäa war am Äquator eine einzige Wüste, auch dort gab es unüberwindbare Barrieren, den heutigen Meeren vergleichbar. Nischen hat es zu jeder Zeit gegeben.“
„Ja, es stimmt. Die Anzahl der Phylen nimmt seit Urzeiten kontinuierlich ab, aber die Spezies differenzieren sich immer mehr. Eine solche Entwicklung ist normal.“
„Nein, ist sie nicht. Genauso, wie der Körper lebt, wenn die Zellen ständig absterben und sich ständig erneuern, leben die Ökosysteme fort, wenn die Spezies sich fortwährend erneuern.iii Die Riffe bestanden früher aus ganz anderen Korallen mit einer anderen Symmetrie, die vielleicht mit den heutigen gar nicht näher verwandt waren, und zu wiederum anderen Zeiten bestanden die Riffe aus Schwämmen und anderen niederen Tieren. Heute hingegen hat der Mensch nicht einzelne Organismen ausgerottet, wir haben ganze Ökosysteme zerstört. Das hat es früher in dem Ausmaß nur bei großen Wasserscheiden der Erdgeschichte gegeben, die in der Regel mit großem Artensterben einhergingen.“
„Dafür haben sich viele Tiere neu verbreiten können. Es ist, als ob Pangäa schlagartig auseinandergebrochen wäre. Viele domestizierte Arten sind nun frei und in Gegenden, in die sie sonst niemals hingekommen wären. Das ist eine Chance!“, entgegnete ich, mich auf verlorenem Posten fühlend.
„Ja, nur leider sind die Nachkommen der gezähmten Tiere dümmer als ihre wilden Verwandten: Hunde verfügen, verglichen mit Wölfen, lediglich über eine rudimentäre Mimik, mehr brauchten sie bei uns Menschen nicht, wir hätten ihre Signale ohnehin nicht verstanden; da ist es besser, sie gar nicht erst zu senden, das kostet nur unnötig Energie, Schafe sind dumpf und können kaum klettern, verglichen mit ihren natürlichen Vorfahren kann man sie nur als „entartet“ bezeichnen, Kühe sind sprichwörtlich „blöd“, die meisten Rassen sind überzüchtet. Selbst Schweine sind beschränkter als Wildschweine. Aber wenn sie jetzt verwildern, haben sie vielleicht eine Chance, bis sich geeignete Räuber entwickeln und ausreichend vermehren, die ihnen gefährlich werden können. Die entarteten Tiere haben somit eine zeitlich befristete Chance. Die meisten Gene sollten noch in ihrem Erbgut vorhanden sein, wenngleich zum Teil durch Züchtung unterdrückt – die könnten sich wieder aktivieren“, fügt meine geliebte Frau hinzu. Ich halte dagegen:
„Alle Spezies sterben aus. Wenn ich es von einer intellektuellen Warte aus betrachte, tut es mir um die Trilobiten genauso leid wie um die Dinosaurier. Und um den Menschen – ich muss zugeben, dass ich es so plötzlich nicht erwartet hatte. Wir waren böse, dafür aber auch interessant.“
„Sag bloß, du bist überrascht!“
Überrascht? Ich träume von zukünftigen Fabeltieren.
„Stell dir vor, in dreißig oder fünfzig Millionen Jahren, wenn nach den letzten Berechnungen, die noch angestellt wurden, der Kontinent Antarktis bei seiner Wanderung in Richtung Indien gemäßigte Breiten erreicht und er, eisfrei, vielleicht von riesigen Fledermäusen bevölkert wird, die so groß sind, dass sie die meiste Zeit am Boden verbringen, mit gefalteten Flügeln, vielleicht in der Art der Flugsaurier, und nur selten fliegen…. – welch ein Anblick! Als fliegenden Tieren wäre es ihnen leichter möglich, dieses neue besiedelbare Land zu erreichen, sobald es grünt und Insekten anzieht. Ich stelle mir vor: Manchmal segeln sie in der Thermik. Ansonsten sind sie nahezu allein, kaum ein anderes Säugetier außer den Nachfahren der Robben wird es ohne Weiteres dorthin schaffen. Ein wenig wie wir…“
„Dich möchte ich sehen, einem solch räuberischen Fledermäuserich gegenüberstehend!“ Meine geliebte Frau lachte laut, sie schien vergessen zu haben, dass ich keine Angst mehr verspürte. Wir beide würden nicht lange genug am Leben bleiben, um derartige Veränderungen zu erleben, das nahm der Auseinandersetzung jegliche Virulenz, es blieb alles nur Träumerei.
Die Antarktis betrachte ich als ein Symbol für unser Leben. Vor Millionen Jahren, als die Antarktis sich gerade vom Urkontinent Pangäa abgetrennt hatte, lebte eine Vielzahl von Tieren in diesem Gebiet. Die Antarktis, eine Insel größer als Australien, wanderte im Laufe der Jahrmillionen in Richtung Südpol und wurde irgendwann unbewohnbar. Die auf ihr lebenden Tiere sind alle ausgestorben, denn fliehen konnten sie nicht – mit Ausnahme der flugfähigen Vögel, einige davon sind wohl davongeflogen, und der Pinguine, sie sind geblieben (oder kamen später, ich weiß es nicht) und haben sich angepasst. Darüber hinaus leben es dort Robben, sonst nichts. Die Pflanzen sind eingegangen, ebenso die Insekten, es gibt auf der Antarktis keine Amphibien, keine Landsäugetiere, keine Reptilien, keine Süßwasserfische, keine Würmer, keine Schnecken, keine Ameisen, keine Käfer, keine Spinnen… – nichts! Früher gab es das alles. Die Kälte hat sie alle ausgerottet. Sie hatten keine Chance, als die Antarktis nach und nach vom Eis bedeckt wurde. Einige Tiere haben sich eine Zeit lang angepasst, haben einen langen Winterschlaf gehalten, ihr Fell wurde dichter und länger, sie versuchten, unter der Erde zu überleben. Es nützte nichts. Sie alle konnten letztlich einfach nicht fliehen. Selbst das große Sterben im Übergang von Perm und Trias hat nicht alle Lebewesen ausgerottet, der (vermutlich mehrfache) Meteoriteneinschlag an der Grenze zwischen der Kreidezeit und dem Tertiär ebenso wenig; die Plattentektonik hingegen hat die Antarktis praktisch sterilisiert, langsam aber sicher. Darwinismus in seiner tödlichsten Ausprägung ist radikaler gewesen als jede plötzliche Katastrophe, was waren wir Menschen schon dagegen? Ich komme noch darauf zurück, sofern ich es nicht vergesse. Wenn die Antarktis sich weiter bewegt, wird das heute vom Eis bedeckte Festland nach und nach wieder Richtung Norden wandern (weiter südlich geht es ja nicht!) und langsam auftauen, zunächst an der Küste, von dort wird dieser Prozess stetig weiter ins Landesinnere voranschreiten. Der Meeresspiegel wird weltweit natürlich ansteigen, genauso wie er einst fiel, als die Antarktis vom Eis bedeckt wurde, nur umgekehrt. Die Antarktis selbst wird sich, wie heute Skandinavien, vom Gewicht des kilometerdicken Eises befreit, etliche Meter heben, was anderswo den Meeresspiegel zusätzlich anheben wird. Die ersten Pflanzen werden sich wieder ansiedeln und nach und nach auch Insekten und Vögel. Fledermäuse vermutlich ebenso. Die anderen Tiere werden es schwerer haben, die Antarktis zu erreichen. In Neuseeland lebten als einzige Vertreter der Säugetiere, bevor der Mensch unter anderem Schafe, Kühe, Schweine, Katzen, Hunde und Ratten einführte, Fledermäuse. In Australien stellten sie die einzigen Vertreter der Plazentatiere (Eutheria) dar, alle anderen ursprünglichen Säugetiere waren den Beuteltieren (mitunter als Metatheria oder Marsupialia bekannt, bemerkt Deep Doubt) zuzuordnen.iv Robben, wie auch immer sie bis dahin aussehen mögen, werden in der Antarktis weiter auf die Küstenregion begrenzt bleiben, vorausgesetzt, sie entwickeln sich nicht wieder zu Landlebewesen, was ich als unwahrscheinlich ansehe. Warum sollten sie, wenn es im Wasser mehr zu fressen gibt? Allein die Fledermäuse und Flughunde (wenn Herr Klaasen mit seiner fast posthumen Annahme, Flughunde seien wie wir mangels Vitamin C ausgestorben, nicht doch Recht behalten haben sollte; ich muss bei Gelegenheit nachsehen, ob ich mit den Augen nicht doch welche entdecken kann) haben als einzige höhere Säugetiere eine reelle Chance, zügig dieses aufgetaute Land zu besiedeln, sobald dort genug Insekten oder Blüten und Obst vorkommen. Auf Inseln neigen viele Tiere ohne Feinde zum Gigantismus (oder aber zu Zwergwuchs, vor allem wenn es sich um kleine Inseln handelt, was im Falle der Antarktis gewiss nicht der Fall ist), ich glaube, meine Vision von der Superfledermaus ist nicht so abwegig, wie meine geliebte Frau tut. Selbst unter dem Aspekt, dass es sich nur um eine Tagträumerei handelt.
Früher schnitten meine geliebte Frau und ich uns gegenseitig die Haare. Mir kam es vor, als wären wir Affen, die sich gegenseitig lausen. Bei den Affen verstärkte es die Gruppenbindung, bei uns konnte es nur die Paarbindung sein. Heute lässt meine geliebte Frau die Haare lang wachsen, ich schneide sie mir ab und an in unregelmäßigen Abständen sehr kurz und lasse sie dann etliche Monate wachsen. Ich komme mir nicht sehr gepflegt vor, mache mir jedoch wenig Gedanken darum. Meine geliebte Frau beschwert sich nicht über mein Aussehen, jedenfalls nicht, solange ich nicht stinke.
Ich halte wieder mit den Augen nach den letzten wenigen verbliebenen Berggorillas Ausschau und entdecke nach einiger Zeit ein einsames Männchen, auf einem Felsen in der Abendsonne am Hang eines erloschenen Vulkans sitzend. Der Gorilla verharrt unbeweglich und tut nichts, außer scheinbar nachzudenken. Er hat die Beine verschränkt, beinahe wie im Lotussitz, die Knie etwas erhöht, darauf ruhen die Ellbogen, das Kinn auf seinen Handflächen, seine Augen blicken traurig, so kommt es mir vor. Diese Stellung scheint mir ungewöhnlich für einen Gorilla, unnatürlich. Es kann an seiner Einsamkeit liegen oder an meinem Wissen über seine Lage. Ich schaue nicht lange zu, es ist doch zu niederschmetternd.
zurück • vor