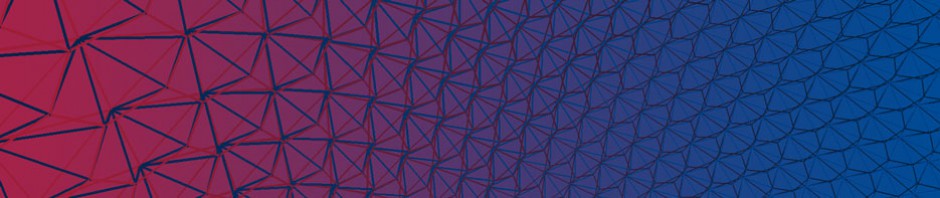In Brüssel wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ungefähr zu der Zeit, die man in Deutschland „Gründerzeit“ nannte, herrliche Jugendstilhäuser gebaut. Die Finanzierung beruhte auf die enormen Gewinne, die aus dem Kongo abgezweigt wurden.i Der bekannteste Architekt dieser Brüsseler Bewegung war Victor Horta. Er entwarf zahlreiche Häuser, Museen, Kaufhäuser, Krankenhäuser und den Zentralbahnhof mit dem schönen Relief zum Gedenken an die 3.012 Eisenbahner, die belgischerseits in den beiden Weltkriegen gefallen sind (ein ähnliches Denkmal, nur kleiner, findet sich im Luxemburger Hauptbahnhof, die Haupthalle steht bis heute). Alles prächtige Gebäude, von denen aber hundert Jahre nach deren Errichtung, in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, nur noch um die dreißig standen. Am kitschigsten und verspieltesten kann man die Geschmacklosigkeit der neureichen Kolonialherren vielleicht am Hotel Van Eetvelde sehen, wo der damalige Generalsekretär für das Kongo, Edmond Van Eetvelde, den Architekten Horta freie Hand und ein Blankoscheck gab.ii Vier dieser Gebäude deklarierte später die UNESCO zum Weltkulturerbe: drei Hotels und das heutige Hortamuseum. Die meisten erhaltenen Häuser befanden sich in der Gegend zwischen dem imposanten Justizpalast (angeblich Hitlers Lieblingsgebäude, obwohl es eine Kuppel hat, die der Kuppel der Synagoge in Berlin zum Verwechseln ähnlich sieht, aber die hatte er ja niederbrennen lassen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde sie wieder aufgebaut, heute ist sie erneut niedergebrannt) und dem Bahnhof Gare du Midi oder im Umfeld der Avenue Louise, beides einstmals gutbürgerliche Wohngegenden. Das war die Avenue Louise bis zuletzt, die Gegend um den Südbahnhof hingegen schon lange nicht mehr. Der unaufhaltsame soziale Wandel hatte aus dieser Gegend ein Zentrum der Einwanderung gemacht, die Bewohner stammten mehrheitlich aus den ehemaligen belgischen und französischen Kolonien. Ihre Kaufkraft war gering, ihr Interesse an belgischer Architekturgeschichte nicht vorhanden. Sie hatten Dringenderes im Kopf. Das nannte man euphemistisch „Migrationshintergrund“.
Die Besitzer der denkmalgeschützten Häuser hatten somit ein Problem. Diese Häuser waren nämlich zu einer anderen Zeit für eine andere Gesellschaft gebaut worden. Sie waren, wie es in Belgien und in den Niederlanden üblich ist, sehr schmal, dafür ziemlich hoch. Für gewöhnlich bestanden diese Häuser aus einem Erdgeschoss, das ursprünglich als Laden angelegt war, einem ersten, repräsentativen Stock, einer zweiten und dritten Etage mit den Wohnräumen für die Familienmitglieder (das war noch die Zeit, in der in einem Haus drei Generationen zusammen wohnten) und einem Dachboden für das Dienstpersonal. Des Weiteren gab es in der Regel einen Keller, der als Lagerraum benutzt wurde, unter anderem für Brennmaterial, Lebensmittel, Wein und – ich spreche schließlich von Belgien – für Bier. In den Niederlanden waren die Häuser schmal, weil sich seit anno Tobak die Grundstückssteuer nach Anzahl und Größe der Fenster richtete. In Belgien maßen die Steuereintreiber die Fassadenbreite, was auf eine ähnlich Bauweise hinauslief: schmale Häuser mit nur vier, fünf oder allerhöchstens sechs Metern Fassadenbreite. Ich habe den Verdacht, dass die Steuereintreiber die Grundrechenarten nicht beherrschten und daher wohl die Grundfläche eines Hauses nicht berechnen konnten. Die Fassade auszumessen, war einfacher und kam dem faulen Naturell eines Steuerbeamten näher. Viele dieser Häuser zierte rückseitig ein meist winziger Garten. Man konnte es von der Straße aus nicht sehen, aber Brüssel war eine ziemlich begrünte Stadt.
Das Problem für die Eigentümer dieser Häuser bestand darin, dass die Architekten (ein Begriff übrigens, der zu dieser Zeit in Belgien zum Schimpfwort wurde) für das gesamte Haus eine einzige Eingangstür vorgesehen hatten. Das ist nachvollziehbar: Hätten sie damals zwei Türen geplant, eine für den Laden unten, eine andere für den Wohnbereich, wäre bei der geringen Hausbreite kaum Platz für ein Schaufenster übrig geblieben. Schaufenster kamen damals dank der Möglichkeit, sie elektrisch zu beleuchten, en vogue. Die Besitzer der Häuser, zunächst mit den Bewohnern identisch, merkten, dass große Schaufenster den Umsatz steigerten und bestanden naturgemäß darauf. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich jedoch die Gesellschaft in den alten Quartieren und die Besitzer bewohnten ihre Häuser nicht mehr selbst: Sie versuchten, sie zu vermieten, das wurde jedoch zunehmend schwieriger – verständlicherweise. Wenn jemand einen Laden mietet, um ein Geschäft zu eröffnen, kann er einen Keller gemeinhin gut gebrauchen, ist aber nicht unbedingt automatisch an drei weiteren Stockwerken und einem Dachboden interessiert, insbesondere wenn er sie nicht untervermieten kann. Niemand will, dass Mieter Zugang zum Laden haben, am Ende klauen sie noch nach Feierabend die Ware.
In den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Eigentümer das Problem durch Abriss ihrer Häuser los. Anschließend wurde auf den frei gewordenen Grundstücken zeitgemäßer und renditeträchtiger gebaut. Diese Vorgehensweise ging so lange gut, bis die Bildungsbürger Belgiens Alarm schlugen und die restlichen historischen Bauten unter Denkmalschutz gestellt wurden. Unglücklicherweise war das Denkmalschutzgesetz unzureichend erarbeitet worden. Typisch Politiker, die denken eben nicht an alles! Mitunter wurden sie geschmiert, um an etwas ganz implizit nicht zu denken, meistens reicht es, an ihre Unfähigkeit zu denken, um ihre Versäumnisse zu begreifen. In Brüssel beabsichtigten die Volksvertreter, den Abriss der Jugendstilhäuser zu untersagen, aber sie dachten nicht daran, deren natürlichen Einsturz zu verbieten. Die meisten Häuser Brüssels waren übrigens keine Jugendstilhäuser, ein Großteil wurde zwischen den beiden Weltkriegen gebaut – nach einem ähnlichen Konzept, mit all den Nachteilen, allerdings ohne die stilistische Sicherheit der nunmehr vergangenen Glanzzeit. Aus dieser Zeit stammt vermutlich die Festigung der bereits erwähnten Benutzung des Begriffs „Architekt“ als Schimpfwort. Jedenfalls waren diese Häuser nicht denkmalgeschützt und wurden weiterhin munter abgerissen. Um diese Häuser war es nicht schade.
Aber um die ursprünglichen. Es sprach sich unter den Besitzern schnell herum, dass es genügte, ein Dachfenster aus Versehen offen stehen zu lassen, damit das ganze Haus nach einem Jahr zur Ruine verfiel und nach spätestens vier Jahren ganz von allein einstürzte. Das Wetter in Brüssel ist sehr regnerisch. Es gibt selten Frost, aber das Regenwasser dringt durch das Holz des Dachbodens, lässt die Dielenböden aufquellen, sprengt den Putz von Wänden und Decken, sickert Stockwerk für Stockwerk nach unten, lässt die alten bleiummantelten Stromleitungen korrodieren und überall Schimmel sprießen, verzieht die Türrahmen, weshalb sich dann die Türen nicht mehr öffnen lassen, lässt manche Fensterscheiben zerspringen, weil die Rahmen ebenso wie die Dielen davor aufquellen, was den Prozess beschleunigt, wohingegen andere Scheiben einfach aus dem Fensterrahmen fallen, weil das Holz morsch wird (das dauert etwas länger) und so weiter und so fort. Zuletzt bleibt den Besitzern nur das übrig, was sie mithilfe der offenen Dachluke von Beginn an vorhatten: der Abriss ihrer Häuser. Den hatte die belgische Gesetzgebung vorgesehen, sie führte diese Möglichkeit unter dem Oberbegriff der force majeur im Gesetz auf.
Später, in den achtziger und besonders in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, kamen mehr und mehr Liebhaber der wenigen noch stehenden Häuser dazu, diese meist billig zu erwerben und teuer zu renovieren, um selber darin zu wohnen. Diese Art des Wohnens galt als schick und sehr repräsentativ, möglich wurde sie aber erst mit dem Zuzug von immer mehr Beamten der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments nach Brüssel – ein Prozess, der sich mit der zunehmenden Erweiterung der EU nach Osten bis weit ins 21. Jahrhundert hinein fortsetzte, sehr zur Freude eines neuen Typus von Spekulanten, dem nicht mehr an dem Verfall der mittlerweile altehrwürdigen Häuser gelegen war.
Heute fliegen wir über viele verlassene Städte und bemerken, wie ein ähnlicher Verfall sich überall breitmacht. Nicht alle Städte sind so verregnet wie Brüssel – manche sind kälter, bei ihnen richtet Frost eine andere Art von Schaden an, andere hingegen sind wärmer, was wiederum Insekten, speziell Termiten, hervorragende Besiedelungsmöglichkeiten bietet.
Immer wieder zerspringen Fensterscheiben. Manchmal fliegt ein Vogel gegen sie, das kommt oft bei Hochhäusern mit Glasfassaden vor. Vögel scheinen diese verspiegelten glatten Flächen nicht als Hindernis wahrzunehmen, mit oftmals tödlicher Wirkung für die Vögel.iii Sind die Vögel groß genug, gehen bei dem Zusammenprall gelegentlich Scheiben zu Bruch. Viele Fenster waren von den letzten Bewohnern offen gelassen worden, sie hatten wohl zuletzt andere Sorgen verspürt. Das Ergebnis lief aufs Selbe hinaus. Die Fenster schlugen im Wind zu und zersprangen ebenfalls früher oder später. Oder Termiten fraßen die Rahmen kahl und die Scheiben fielen von selbst heraus. Stürme deckten Dächer ab, Ziegelsteine zerschlugen Scheiben, die abgedeckten Häuser verfielen, die mit den eingeschlagenen Fernstern ebenfalls. Und manchmal brannten die Häuser auch ab.
Wenn niemand da ist, um Feuer zu bekämpfen, können ganze Städte abbrennen. Das kann spektakulär aussehen und wir schickten immer wieder unsere Augen los, um diese Vorgänge aufzunehmen. Unglücklicherweise entwickelten die wüstesten unter diesen Bränden in ihrer Gier nach frischem Sauerstoff einen solchen Sog, dass wir so manches Auge verloren. Sie wurden, zum Teil aus beträchtlicher Entfernung, einfach eingesogen. Dieser Verlauf war mir eine Lehre und ich merkte mir gut: Niemals zu nahe an große Feuer fliegen!
Besonders umwerfend, obwohl viele Ruinen als Gerippe lange stehenblieben, waren Hochhausbrände. Wenn sie dann doch einstürzten, die Trägerstruktur von der Brandhitze geschwächt, rissen zahlreiche Häuser in dichten Ballungszentren Nachbarhäuser im Dominoeffekt mit hinunter. Viele brannten oder schwelten am Boden zerschmettert weiter. Die Archäologen der Zukunft, die es wohl nicht mehr geben wird, hätten etwas, um sich zu wundern.
Allerdings: Was mächtige Brände angeht, waren Städte im Vergleich zu Raffinerien, Hafenlagern und Industriegebieten zu vernachlässigen. Wälder brannten ebenfalls unablässig, heftig und lange. Aber das ist wohl normal.
Wir schauten untätig zu. Wie jedes Mal. Was gab es da schon zu tun in unserer Lage?
zurück • vor