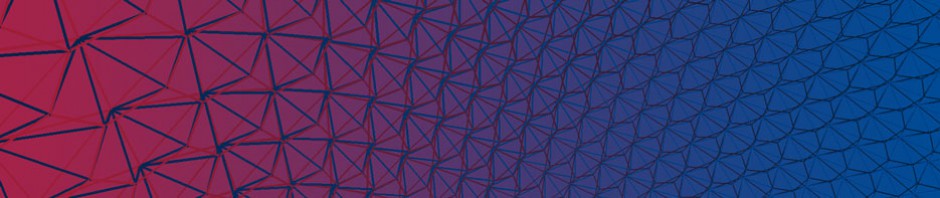The past is not over. In fact, it is not even past.i
William Faulkner
Was war vom Menschen übrig geblieben? Vieles, einiges davon sehr sichtbar, wie zum Beispiel Städte, Straßen, Hafenanlagen… Einiges unsichtbar, etwa weil es mikroskopisch klein war (die bereits erwähnten Kunststoffrückstände, fein zerrieben. Was nicht bedeuten soll, es gäbe nicht genug makroskopisch bemerkbare Plastikfetzen in der Umwelt). Ich machte mir wohlgemerkt nicht die Mühe, Boden- und Wasserproben unter dem Mikroskop zu analysieren, aber mir ist natürlich bewusst, dass es diese zerriebenen Kunststoffe nach wie vor gibt. Selbstverständliches muss ich nicht nachprüfen. Anderes war unsichtbar und daher nur mit chemischen Analysemethoden nachzuweisen – Methoden, die wir nicht beherrschten, dennoch ist mir ebenfalls sehr klar, dass es POPs (Persistent Organic Pollutants, auch als Dauergifte bekannt), PCBs (Poly-Chlorated Biphenyls), die bereits erwähnten FCKWs und die Chlorfluorkohlenverbindungen und die Fluorkohlenwasserstoffverbindungen, Dioxine, Furane, Kadmium, Blei, Arsen, DDT, Quecksilber, Chrom und vieles mehr überall geben kann und häufig tatsächlich gibt.
Etwas, das man durchaus ohne Instrumente wahrnehmen kann, ist der Gestank, den wir Menschen hinterlassen haben. Es gibt evidente Gestankvarianten wie die, die aus Mülldeponien ausströmen, heute noch. Halb so wild. Dann gibt es den Gestank, der aus dem herausströmt, was der Mensch früher mit Wasser gefüllt hat. Schwimmbäder zum Beispiel sind aus der Nähe schwer auszuhalten, selbst wenn sie leer sind.ii Im kargen Südosten Madrids, südlich von Coslada, existieren Siedlungen aus der Bauboomzeit um die Jahrtausendwende, wo kilometerlang Reihenhäuser an schwungvoll gewundenen Straßen gebaut wurden, jedes mit einem eigenen Schwimmingpool an der Rückseite. Daran grenzt eine weitere Reihe Schwimmbecken, hieran anschließend die Rückseite der Reihenhäuser der nächsten Straße. Die Gärten bestehen praktisch nur aus aneinandergereihten Schwimmbecken, aus zwei Reihen, um genau zu sein. Das ist nicht nur ökologischer Unsinn, es muss im Sommer die Hölle gewesen sein: Kindergebrüll und Chlorgestank. Von oben, aus den Augen, sahen die Becken schön blau aus, früher. Heute sind sie grün und braun. Nicht nur die mit den menschlichen Leichen darin stinken erbärmlich.
Nicht wenige Schwimmbecken sind lediglich zur Hälfte gefüllt und schwarz vor Mückenlarven, andere versanden und füllen sich mit Laub und Plastik. Viele werden zur Falle für Tiere: Frösche, Biber, Faultiere, Schleichen, Maulwürfe, immer wieder Bären, einmal sah ich sogar ein totes verfaultes Nilpferd in einem Schwimmbecken in den Außenbezirken von Bogotáiii, Kängurus, Hunde, Schafe, Pferde, Kühe, Wombats, Hasen… Wenn die Schwimmbecken keine Stufen am Rande aufwiesen oder die Leiter abgebrochen war bzw. nicht bis zum herabgesenkten Wasserstand reichte, ertranken oder verhungerten sie. Kleine Tiere, wie Eidechsen, Geckos, alle möglichen Mäuse, die meisten Vögel, die kleinen allemal, die keinen Anlauf zum Abheben nehmen müssen, konnten ohne Schwierigkeiten entkommen. Ich schätze, manche dieser Fallen werden sich für bestimmte Tierarten Jahrhunderte lang als tödlich erweisen, wenn sie nicht versanden. Die Seitenwände, vom Erdreich gestützt, werden nicht wasserdicht, aber lange stehen bleiben. Die meisten verschlammen mit der Zeit, besonders die in den Gegenden mit einer ausgeprägten Regenzeit. Gerade sie sind gefährlich, wenn unter einer zerbrechlichen Kruste ein weicher, schmieriger, giftiger Schlamm bleibt.
Wir haben die Welt wie ein mittelalterliches Schloss gestaltet, mit Gruben und Mauern um uns herum. Schwimmbecken und Zäune. Minenfelder obendrein. Heute schwebt die Hyperborea, ein letztes bewohntes Schloss, durch die Luft. Unter uns der tiefste Graben, so tief, wie ich aufzusteigen wünsche. Mauern brauchen wir keine, wir haben Wände. Mit unseren Augen sehen wir die ganze Welt. Ein verlassenes, heruntergekommenes Haus des Menschen.
Ist es nicht feige, wie wir uns aus dem Staub gemacht haben? Wir, die Menschen, indem wir einfach verschwinden. Wir, meine geliebte Frau und ich, indem wir uns über die Tatsachen erheben, wortwörtlich. Ich habe keine Angst, auch nicht vor da unten, vor dem festen Boden. Wirklich nicht. Ich habe sogar den Mut, mir einzugestehen, dass man auch ohne Angst feige sein kann. Und träge und bequem. Wir bleiben hier oben.
Kläranlagen lassen Schwimmbäder wir Duftwasser dastehen. Eine ganz besondere Note entwickeln die großen Aquarien, wie zum Beispiel das Ozeaneum in Stralsund mit seinen neun großen Becken, das größte davon, das Schwarmfischbecken im Nordsee-Rundgang, mit sagenhaften 2,6 Millionen Litern Fassungsvermögen, dazu unzählige kleine Becken und Aquarien. Ehedem eine sehr hübsche Einrichtung, aber Gleiches gilt selbstverständlich ebenso für die Anlagen in Valencia (el Oceanográfico), in Genua bei Ponte Spinola, in Barcelona im Zoologischen Garten, in Vancouver, in Orlando, Florida, im Monterey Bay Aquarium an der literarischen Cannery Row, in New Yorks Aquarium in Brooklyn, an der Kreuzung der Surf Avenue & West 8th Street, in Sydney am Darling Harbour oder im Aquarium in Okinawa (ja, da, wo der letzte G23-Gipfel stattgefunden hat. Dieses Aquarium war wirklich groß! Sie hatten sogar mehrere Walhaie in Gefangenschaft gehalten! Meines Wissens gab es Walhaie nur noch im Georgia Aquarium in Atlanta, an der nach Sherlock Holmes’ Nachbarschaft klingenden 225 Baker Str., allerdings waren dort die Walhaie nicht richtig ausgewachsen). Auch The London Fishhouse am Londoner Zoo in Regent’s Park, wo das erste dem allgemeinen Publikum zugängliche Aquarium im Jahre 1854 von Phillip Henry Goose eröffnet wurdeiv, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wenn ich schon einige Anlagen aufs Geratewohl genannt habe, verdient diese auf jeden Fall einen Platz in der Aufzählung. Aquarien scheinen in den reichen westlichen Städten, im reicheren Asien und in den Golfstaaten, wo sie zum Luxussymbol wurden, sehr populär gewesen zu sein – ich mochte sie einst gleichermaßen. Und jetzt ist es überall dasselbe, nicht nur in Wilhelmshaven: Ohne Strom wird die Filteranlage nicht betrieben, ohne Menschen werden die Fische nicht gefüttert. Zuerst müssen die Fische sich gegenseitig aufgefressen haben, sofern sie dazu in der Lage waren. Das hing wohl davon ab, was die Meeresbiologen in den jeweiligen Wassertanks zusammengeführt hatten. Bald muss es egal gewesen sein, wer wen gefressen hatte, denn auch die Räuber müssen dem Sauerstoffmangel zum Opfer gefallen sein. Selbst die Bewohner der größten offenen Tanks – das Nordsee-Becken in Stralsund war allein fünf Stockwerke hoch und wies vierzig Meter im Durchmesser auf – hatten ohne die Belüftungsanlagen keine Chance zu überleben. Die Wasseroberfläche war kaum groß genug, um ohne Zwangsbelüftung einen Schwarm Sardinen am Leben zu erhalten, aber selbst die hätten nichts zu fressen gehabt. Die größeren Fische – Makrelen, Haie, Thunfische, Rochen, Muränen, desgleichen die Süßwasserfische… – keine Chance. Die kleinen Lebewesen – Seesterne, Seeigel und andere Stachelhäuter, Krebse und kleinere Gliederfüßer, Nematoden oder Fadenwürmer, wie sie in der Vernakularsprache heißen, Plathelminthes oder Plattwürmer, Gastropoden oder Schnecken, Mollusken oder Weichtiere, alle möglichen Kriechtiere… – alle waren gefangen. Selbst die kleinsten und einfachsten Algen konnten ohne Licht nicht überleben und ohne Strom gab es in diesen Bauten nicht einmal Licht, die Architekten hatten kein Sonnenlicht vorgesehen, um die Tageszyklen auf Wunsch der betreibenden Wissenschaftler besser steuern zu können. Tageslicht hätte bei einer so schönen Anlage nur gestört, ist es doch Tagesschwankungen ausgesetzt – je nach Wetterlage – und Jahresschwankungen – je nach Jahreszeit. Man wollte alles unter Kontrolle haben, nun ist alles im Eimer. Ein sehr großer, stinkender Eimer wohlgemerkt. Als alle ursprünglich ausgestellten Lebewesen, Tiere wie Pflanzen, eingegangen waren, übernahmen die anaeroben Bakterien den Dienst. Da wusste ich wenigstens, was dieser Gestank verursachte: Schwefelwasserstoff. Das Gas, das faulen Eiern ihre Duftnote verleiht; das Gas, das im Kivu-See Millionen Menschen und Tiere umgebracht hatte. Soweit eine kurze beispielhafte Beschreibung des Aquariums in Stralsund, bevor es durch die Wartungsschächte und die Nachfüll- und Kontrollanlage hindurch undicht wurde und seinen längst fauligen Inhalt in die Keller ausleerte. Undichte Becken machten die Situation in der Nähe der Aquarien immer wieder unausstehlich. Weltweit finden sich unzählige andere Aquarienanlagen: Allein in Berlin gab es nicht nur das Aquarium am Zoo, das ist ja recht klein gewesen. Es gab zudem den zylindrischen Wassertank im Radisson SAS Hotel am Alexanderplatz (sechs Stockwerke hoch, in der Mitte mit einem Fahrstuhl mit durchsichtigen Wänden) und die sechsundzwanzig öffentlichen Hallenbäder, die der Senat sich zuletzt noch leisten konnte, und den Strömungstunnel der TU Berlin, eine Art Windkanal für Schiffe, und die Freibäder, die sich mit Laub füllten. Zusätzlich die Keller, die vollliefen, sie stanken ebenso. Und die U-Bahn, die in Berlin zwar sehr oberflächennah gebaut wurde, aber dennoch voll mit Wasser lief. Berlin tat mir richtig leid.
Eine Besonderheit hat Berlin aber doch, die möchte ich nicht unerwähnt lassen: das Olympiastadion. Das Olympiastadion wurde unweit der Havel für die Olympiade 1936 erbaut, mit all den für jene Zeit in Deutschland typischen nationalsozialistisch-überrealistischen Statuen von athletischen Übermenschen, aus wuchtigem Granit und Sandstein allenthalben. Eine breite, für Massenaufläufe geeignete Promenade (ehemals Reichssportfeld) führt zum Stadion mit seinen Tribünen für Zehntausende, mit dem nach Osten offenen Marathontor, durch das die Strahlen der untergehenden Sonne auf das Spielfeld fallen (mit den dazugehörigen Aufnahmeproblemen am Nachmittag, was meine alten Kameras mit der Kraft der zwei Chips sehr gut ausglichen), und seinem um die letzte Jahrhundertwende herum nachträglich eingebauten Dach. Die Nazis wollten die Welt mit den ersten unumwunden politischen Spielen der Neuzeit beeindrucken und es ist ihnen wohl gelungen. Das Stadion war riesig, zu riesig für die damaligen architektonischen Möglichkeiten und vor allem für das damalige Budget der frisch an die Macht gekommenen Nazis im reparationsgeschwächten Deutschland. Die Lösung für diese Not war so einfach wie genial: Man baute das Olympiastadion nicht ebenerdig, sondern zum Teil nach unten. Das nennt man in der Fachsprache ein Erdstadion, das Berliner Olympiastadion ist also zur Hälfte ein Erdstadion. Die Spielfläche liegt etliche Meter unter dem Niveau der Eingangsebene. Die Tribünen graben sich trichterförmig in den Boden, allein die oberen Ränge sind in die Höhe gebaut. Von außen merkte man das nur, wenn man um diese Bauweise wusste. Jetzt jedoch fällt es auf, weil das Grundwasser steigt und der Boden sich senkt. Vermutlich ist ebenso ein Teil der Gasreserve ausgetreten, die unterirdisch in diesem Bereich für Notfälle gelagert wurde, im Geiste der Berlin-Blockade, und der Boden dementsprechend abgesunken. Das Olympiastadion ist zum Teich geworden. Das nicht mehr ganz neue Dach steht noch und in der Mitte glänzt das Wasser, ruhig, schleimig grün. So etwas hat nicht jeder, würde der Berliner wohl sagen, in seinem provinziellen Stolz…
Um Venedig ist es allerdings noch viel schlimmer bestellt. In der Lagunenstadt werden regelmäßig alle niedrig gelegenen Bereiche, Keller und Plätze überflutet, später trocknen sie wieder. Alles verschlammt, überall Mückenbrutplätze: Pfützen, zur Hälfte versenkte Gondeln, der gesamte Markusplatz ist mit einer Schlammschicht bedeckt, die Tauben sind verschwunden. Algen ohne Ende. Die Gewässer werfen Blasen, die Lagune ist umgekippt. Wenn die Augen tief und langsam über Venedig fliegen, werden sie von Mückenschwärmen regelrecht der Sicht beraubt. Aus der Höhe sieht man die schwarzen Wolken hin- und herschwirren.
Ich hatte einst die Lösung gegen Mücken gefunden und diese nicht durchsetzen können. Jetzt bedauerte ich es: Ich bin gleichbleibend sicher, dass meine Methode, im großen Maßstab angewandt, erfolgreich gewesen wäre.v Heute gibt es zunehmend mehr Mücken, meine erfolgloseste Erfindung käme jetzt gut zum Tragen. Es sollte nicht sein, es wird nicht mehr sein. Gut, dass wir an der Hyperborea feine Netze an den Fenstern angebracht haben. Jedenfalls an den Fenstern, die sich öffnen lassen, an den anderen wären sie überflüssig. Durch die große Ladeluke dringen ab und zu Insekten ein, damit muss man leben. Deshalb komme ich von der Ladeluke oft durch den Raum mit den Flüssiglufttanks in die Hyperborea zurück. Die Kälte wirkt wie eine Schleuse für Insekten.
Als die ganz großen Stinker im Bereich des Wassers treten die Staudämme hervor: Weltweit liefen sie bei jedem Platzregen ein wenig mit Schlamm voll. Selbst die ganz Großen brachen selten zusammen: Der Assuan-Staudamm, der Hoover-Damm, die Dämme an den Flüssen Obi, Jenissej und Lena, Itaipu an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay und unzählige kleinere Dämme, Talsperren, Stauseen und Staubecken füllten sich langsam mit Schlamm und versandeten. Der Drei-Schluchten-Damm allerdings brach bereits vor zwei Jahren spektakulär zusammen. Darüber rede ich lieber ein anderes Mal. Schlamm als solcher stinkt schon, wenn jedoch dessen Oberfläche in der Trockenzeit aushärtet, weil der Wasserpegel sinkt, müssen die durstigen Tiere über diese vermeintlich feste Kruste laufen, um zum Wasser zu gelangen. Wenn sie einbrechen, ertrinken sie in einer schleimigen anaeroben Paste – wenn sie Glück haben. Das bedeutet einen schnellen Tod, diese Tiere werden eventuell eines Tages zu hübschen Fossilien. Ob sie wohl jemand finden wird? Wenn sie nicht ganz einbrechen, sind sie gefangen. Dann sterben diese armen Tiere inmitten des Gestanks den Hungertod oder – schneller und öfter – an Durst. Vögel und leichte Raubtiere fressen das auf, was aus dem Schlamm herausragt. Schwerere Aasfresser brechen ebenfalls ein und starten einen tödlichen Zyklus, nicht unähnlich dem der Minen, wie wir ihn in Afrika erlebt haben, aber vermutlich langlebiger.
Am Rhein sind die Dämme zu Staudämmen geworden, die Konstruktion, die das Wasser fernhalten sollte, hält das Wasser nun auf der anderen Seite fest: In den weiten Gebieten links und vor allem rechts des Rheins sind, von den zusammenbrechenden Galerien der Kohlebergwerke gesenkt, große Bereiche überflutet. Manche Häuser ragen heraus, man sieht ständig Ölflecken an der Wasseroberfläche schimmern. Die Bäume sind gestorben, ihre Wurzeln verfault, die Äste ragen nun kahl in den Himmel, im Winter wie im Sommer.
Am Flughafen Schiphol in Amsterdam, schon ohne Erdabsenkung vier Meter unter N.N., schwimmen die größten Flugzeuge bis zu den Tragflächen im Wasser. Von den Kleinen sieht man nichts oder gerade noch das Ende der Heckflosse. Die Flugsteige ragen ins Wasser, sie führen keine Passagiere mehr in die Flugzeuge. Über die Hälfte der Niederlande ist überflutet. Von Schiphol sieht man aus der Hyperborea in der Ferne Rotterdam, die Raffinerien, die teilweise immer noch kokeln, den Hafen, in dem die großen Schiffe vor sich hin rosten, und die hoch gestapelten Container.
Zu guter Letzt sondern die Toten selbst einen ziemlichen Gestank ab: Dort, wo viele starben und nicht begraben wurden, riecht man ihn noch heute. Ich will dort nicht näher heranfliegen, ich halte es einfach nicht aus. Die Augen zeigen, dass manche Menschen nicht gern allein gestorben sind. Oder, dass sie von ihren Mördern zusammengetrieben wurden. Wie viele Menschen lebten es zuletzt? Man schätzte offiziell, wir seien um die 7,8 Milliarden gewesen. Wie viel Menschheit war das? Wenn die Fahrstuhlhersteller als Maßstab herangezogen werden dürfen, und ich will einmal davon ausgehen, dass sie wissen, was die Fahrstühle befördern und wie viel ihre Last wiegt, dann entsprachen (zumindest laut Typenschild im Lift damals bei mir zuhause) 400 kg fünf Personen: also 80 kg pro Mensch. Mit Mensch waren bei uns in Berlin in diesem speziellen Fall vermutlich erwachsene, gut genährte Westler gemeint; in einer Welt mit vier Milliarden Hungerleidern und etwa gleich vielen Minderjährigen dürfte das Durchschnittsgewicht eher bei 60 kg gelegen haben. Frei aus dem Bauch geschätzt. Das ergibt, über den Daumen gepeilt, für uns alle ein Gesamtgewicht von 450.000.000 Tonnen. Menschen haben in erster Annäherung eine Dichte von einem Kilogramm pro Liter, etwa so viel wie Wasser, deswegen können wir sowohl schwimmen als auch tauchen. Das bedeutet, gut geschichtet hätten wir alle in einen Würfel mit einem Kilometer Kantenlänge gepasst und hätten diesen nicht einmal bis zur halben Höhe gefüllt: Bei 450 Metern wäre Schluss gewesen. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz, bis vor Kurzem Deutschlands höchstes Gebäude, misst insgesamt keine 370 Meter bis zur Spitze der Antenne; die Kugel mit der berühmten Aussichtsplattform befindet sich viel tiefer, in wenig mehr als 200 Metern Höhe. An dieser Stelle könnte man einige Rechenbeispiele durchspielen: Wie viel Fremdmaterial wäre in diesem hypothetischen Würfel enthalten? Das kann ich nur schätzen. Wenn die Menschen nicht nackt gestorben sind oder nachträglich ausgezogen wurden, was wohl unwahrscheinlich ist, schätze ich, dass jeder ein Kilo Klamotten am Körper getragen hat. Das entspräche 7,5 Mio. Tonnen Kleider mit allem, was dazugehört: Knöpfe, Druckknöpfe und Reisverschlüsse zum Beispiel und da könnte man alles hinzuzählen, was die Menschen in ihren Taschen (sollte ich Damenhandtaschen hinzuzählen? Lieber nicht, sonst wird es unübersichtlich) mit sich herumtragen, wie beispielsweise Geld, Taschentücher, Feuerzeuge, Schlüssel, Handys, Kaugummis, Bonbons, Amulette, Talismane, die nun kein Glück mehr bringen oder Andenken an Vergangenes. Und im Körper der Toten selbst werden sich noch Tonnen von Herzschrittmachern befinden mit Batterien, die vielleicht Quecksilber enthalten oder Cadmium, einige alte Modelle enthielten sogar Plutonium, und Zahngold, das haben die Nazis den Juden gestohlen, es war wohl nicht wenig, obwohl es sich bei den Juden nur um Millionen Menschen und nicht um Milliarden handelte. Demzufolge müsste man, um das zu schätzen, wissen, wie viel Gold die Nazis aus den Zähnen der Lagerinsassen gestohlen haben, und die erhaltene Kilogramm-Zahl in Tonnen umrechnen. Sicher gibt es mehr Amalgam als Zahngold und sogar Zahnstahl, in Russland zum Beispiel war das geläufig. Einige Menschen haben Stahl- und Titanplatten im Körper, andere Stahlschrauben oder künstliche Gelenke an Knien und Hüften. All das sortenrein zu trennen, wäre ein Recycling-Alptraum. Früher hat Dänemark es versucht, mit einzelnen Leichen im Krematorium. Zwischen dem Jahr 2006 und Mitte 2009 haben die 31 Krematorien des Landes 77.762 dänische Kronen (DKK) mit dem Verkauf von 4.810 Kilogramm Altmetall an einen niederländischen Recyclingunternehmer verdient.vi Was Deep Doubt nicht alles an Daten parat hat! Mit einzeln entsorgten Leichnamen in einem kleinen Land war Recycling noch gangbar, sogar die Verbrennungshitze wurde von den pragmatischen Skandinaviern zu Heizzwecken genutzt. Aber auf die gesamte Menschheit umgelegt, ist diese Vorgehensweise nicht mehr so einfach, genau betrachtet zudem nicht wirklich sinnvoll. Nicht zu vernachlässigen sind ferner die natürlichen körperlichen Sekrete, die schleppen wir ja ebenfalls stets mit uns: Wie viel Urin schieden all die Menschen täglich aus, wenn jeder Mensch einen Liter Urin am Tag erzeugte? 780.000 Kubikmeter, genug, um 300 olympische Schwimmbecken zu füllen. Täglich. Die Fäkalien machten vermutlich noch einmal halb so viel aus. Alles wäre also in diesem hypothetischen Würfel vermischt. Solche Dimensionen sprengen das normale menschliche Vorstellungsvermögen. Wer kann sich einen Würfel mit einer Kantenlänge von einem Kilometer bis zur Höhe von 450 Metern mit Menschen gefüllt vorstellen? Die Menschen bilden sich ganz besonders auf ihre intellektuellen Fähigkeiten etwas ein und die sind im Gehirn verankert – einem Organ, das zwischen zwei und vier Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, im Durchschnitt also drei Prozent, um eine konkrete Zahl zu nennen. Der Würfel mit der Kantenlänge von einem Kilometer wäre demnach dreizehn Meter hoch ausschließlich mit menschlichen Gehirnen gefüllt. Die oberen dreizehn Meter oder eher die unteren? Egal, lassen Sie mich ein einfacheres Beispiel nehmen: Das größte (und schönste) Stadion Europas war das Camp Nou, seit 1957 Spielstätte des F. C. Barcelona. Mit einer Länge von 250 Metern, einer Breite von 220 Metern und einer Höhe von 48 Metern hätte man dieses Stadion mehr als zweihundertfach mit den Kadavern der Menschheit füllen können. Drei Prozent von zweihundert sind sechs, demnach hätte man das Stadion sechsmal mit den menschlichen Gehirnen füllen können. Mit füllen meine ich natürlich, schichtweise auffüllen, vom Rasen bis zur Oberkante des Tribünendaches – kompakt, einschließlich aller Gänge, Treppen, Logen, Verwaltungsräume, Imbisse und Restaurants, der glorreichen Trophäenräume, überhaupt alles: randvoll. Sechsmal. All diese Menschenkadaver – mit den ehedem so stolzen Menschenhirnen, mit den übrig gebliebenen Körperausscheidungen, auf dem Planeten ungleichmäßig verteilt, mit Klumpen in den großen Städten – ergeben stets aufs Neue ein Gestank wie Pest und Cholera gepaart mit Wundbrand, selbst Jahre später noch.
Nicht zuletzt erleben wir den verwandten Gestank der tierischen Fleischberge. In Reken an der niederländischen Grenze im Münsterland befindet sich eine bemerkenswerte Kühlhalle mit angeschlossenem Tiefkühlkostwerk. Sie umfasst über eine Million Kubikmeter (verglichen mit der Menge an toten Menschen sind das Peanuts, aber konzentrierte Peanuts) und enthält so viel Fleisch, Fisch und vermutlich sogar Gemüse, dass bis heute, sieben Jahre nachdem die Lichter ausgingen, ein Teil der Ware immer noch gefroren sein dürfte. Der Inhalt der Halle entspricht einem riesigen blutigen Eisberg, der an den Rändern langsam auftaut und sogleich verfault, während der Kern in den gut isolierten Hallen weiter unter dem Gefrierpunkt verharrt. Die Augen, die ich in die Nähe schickte, um zu erforschen, was von dieser Halle an hauptsächlich in Richtung Osten (der Hauptwindrichtung) passiert, das selbst die Wälder fünfzehn Kilometer weiter weg hat vergilben lassen, kamen dermaßen verpestet zurück, dass ich sie nie wieder in die Nähe der Hyperborea kommen ließ. Ich nehme an, sie stinken heute nicht mehr so ekelerregend, aber ich will die Probe nicht machen müssen. Es gibt viele solche Einrichtungen, dasselbe Unternehmen aus Reken hat zum Beispiel überdies in Bremerhaven die ehemalige sogenannte Fischverarbeitungsanlage betrieben, aus der stammten früher nahezu alle Fischstäbchen Deutschlands – die hat es ebenfalls in sich. Glücklicherweise haben wir genug andere Augen. Zur Not haben wir die Augen in Reserve in Berlin innerhalb des Planetariumtunnels und in Japan, an dieser Stelle sei Nagasaki genannt, in der Einkaufspassage (in Japan finden sich viele Einkaufspassagen) und in manch einem offen gelassenen Hangar hier und da, im Mont-Blanc-Tunnel und vor allem in den vielen modernen Bahnhöfen mit ihren verglasten Dächern, da konnten die Augen sogar ihre Sonnenkollektoren nutzen. Also kurz: überall auf der Welt, wo sie hineinfliegen können, vor Wind und Regen geschützt sind und ohne fremde Hilfe vor Ort (die es nicht gibt und schon gar nicht, wenn man sie braucht) wieder ferngesteuert hinausfliegen können. Dort waren sie gut aufgehoben, wir besaßen ohnehin zu viele, wir konnten die vielen Bilder gar nicht auswerten. Für die Ferne achteten wir zunehmend auf die Bilder der Vendobionten, die ermöglichten uns einen besseren Überblick. Viele Augen flogen blind auf Autopilot, einzig für die nähere Umgebung der Hyperborea nutzten wir sie aktiv. Beide autonome Luftschiffarten, die Augen und die Vendobionten, waren nach wie vor so programmiert, dass sie sich möglichst gleichmäßig über die ganze Welt verteilten. Wir verfügten über genügend Augen für eine ganze Weile und neben den vielen, die wir gelagert hatten, blieben genug übrig, um erratisch von hier oder da Bilder zu funken und um Not eines in der Nähe zu haben, beinahe egal wo, wenn wir es nötig haben sollten. Diese Not stellte sich selten ein: Es gab nicht oft einen logischen Grund, ein Auge irgendwohin zu schicken, sofern wir nicht wussten, was es dort zu sehen gab, und wenn wir es wussten, dann für gewöhnlich, weil es dort bereits ein Auge gab. Wenn für unsere Augen eine Einschränkung galt, lag diese nicht an deren Anzahl oder Verfügbarkeit, sondern am Wetter, wie seit ewigen Zeiten, und daran, dass meine geliebte Frau und ich allein wenig im Detail überwachen konnten. Die Vendobionten flogen ohnehin in so großer Höhe, dass sie praktisch unverwüstlich und vom Wetter vollkommen unabhängig waren. Sie lieferten uns das grobe Bild, das in der Regel ausreichte.
Wiederum andere Augen nahmen zum Beispiel den Baikalsee und seine untreue Tochter, die Angara, auf. Die eingeborenen Burjaten verehrten, lange bevor der „Weiße Mann“ ihr Gebiet (und sie mit) eroberte, diesen südsibirischen See, von dem es heißt, er sei der tiefste und der älteste der Erde, und dichteten ihre Mythen um ihn herum. In einem dieser Mythen heißt es unter anderem, der Baikalsee (in der Sprache der Burjaten der „reiche See“) sei ein alter Mann, dem all seine Kinder und Enkelkinder Respekt zollen. Seine Kinder sind natürlich die etwa 336 größeren Zuflüsse und Bäche und die unzähligen Sturzbäche, die den See speisen. Einzig eine Tochter, Angara, hätte sich in einen fremden Schönling verliebt und sie verließ als Einzige den Vater, um ihren geliebten Jenissej zu ehelichen. Daraufhin habe der Vater, erzürnt über die flüchtige Tochter, mit einem Stein nach ihr geworfen und tatsächlich ragt an der Mündung des Baikalsees, dort wo die Angara dem alten Vater davonfließt, ein mächtiger Findling aus dem Wasser. Viele Jahre lang war dieser Stein kaum zu sehen gewesen, denn die Angara wurde vom Irkutsker Stausee zurück gestaut. Das Niveau des Flusses stieg vom Staudamm an der Stadtgrenze Irkutsks bis zum Baikalsee zurück, etwa 60 Kilometer flussaufwärts, und begrub den Stein unter den Fluten des Sees oder der angewachsenen Angara – je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachten will. Heute sieht man den Stein mitten in der Angara-Flussmündung wieder. Der Staudamm ist unterspült worden, das Kraftwerk zerstört, die Stadt Irkutsk überflutet und wieder getrocknet. Hier stinkt es ebenfalls aus allen Häusern, insbesondere den eingestürzten. Allein im Winter friert der Gestank ein zusammen mit dem See, der Angara, und den restlichen treuen Kindern des alten Baikal, alle 336 plus die gelegentlichen Sturzbäche, die erst im Frühling mit der Schneeschmelze und dem Regen wieder zum Leben erwachen werden.
Der aikalsee selber ist hingegen wunderbar sauber und stinkt nicht. Am südöstlichen Ufer sonnen sich im Sommer die Baikalrobben, die einzige Robbenart weltweit, die ausschließlich im Süßwasser lebt. Die Robben fischen gelegentlich nach Omul, einer kleinen fettreichen, sehr schmackhaften endemischen Lachsart. Im Winter friert der gesamte See ein, Eisschollen schichten sich, vom Wind getrieben, teilweise meterhoch übereinander. Dann verteilen sich die Robben über das gesamte Seegebiet und versuchen, mit ihren Zähnen und Krallen ein Eisloch zum Atmen freizuhalten, ununterbrochen, Tag und Nacht, den ganzen Winter lang. Die Zähne nutzen sich bei den Baikalrobben schnell ab, am Ende friert das Loch zu und sie ertrinken unter Wasser oder sie erfrieren auf dem Eis. Aber diese Todesursache ist für diese Robbenart natürlich, ihre Reproduktionsrate ist diesem Umstand angepasst. Jetzt, wo keine Menschen mehr ihren Lebensraum stören, kommen sie offenbar sehr gut darin zurecht. Von Zeit zu Zeit gebären sie Zwillinge, was bei Robben äußerst ungewöhnlich ist, aber das habe ich aus alten Berichten und Aufzeichnungen abgeschrieben. Wenn ich darüber nachdenke, komme ich eher zu dem Schluss, dass sich diese beiden Aussagen widersprechen. Ich kann heute beim besten Willen nicht wissen, wie alt eine bestimmte Robbe ist oder wie lange sie noch leben wird. Das sind die Fragen, die ein Mensch – allein auf sich selbst gestellt oder selbst zu zweit – nicht mehr beantworten kann, egal, wie viele Augen ihm zur Verfügung stehen.
zurück • vor