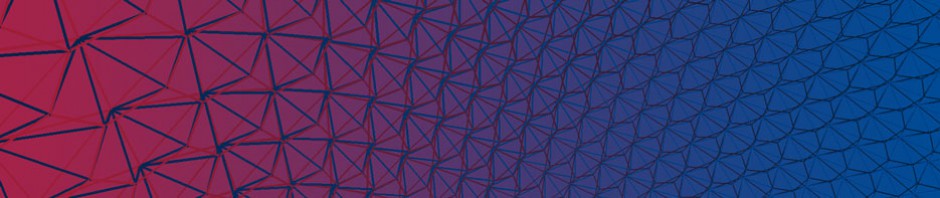All that is needed for evil to prosper is that good men do nothing.i
Edmund Burke
Geistiger Vater des Konservatismus
Leider hatte arabis mit den schwarzen Rhinozerossen auf das falsche Pferd gesetzt, es war irrelevant, ob sie die Wilderer in Kenia hatten erschießen lassen oder nicht, weil das nächste große Säugetier, das ausgerottet wurde, der Berggorilla war. Und das geschah auf besonders perfide und beleidigende Art und Weise, nämlich mit Vorsatz. So kam es im reichen Westen jedenfalls an: als Affront. Ich glaube, es war auch so gemeint, wie man an den Bekennerschreiben sehen konnte. Es kann sich natürlich um Trittbrettfahrer gehandelt haben, aber das ist nicht mein Eindruck.
Man konnte schon Argumente finden, die das rechtfertigen konnten, was im Virunga Nationalpark, bei seiner Gründung 1925 Albert-Nationalpark genannt, geschehen war. Oder wenn schon nicht rechtfertigen – denn es gibt Verhalten, die sich wirklich nicht rechtfertigen lassen, egal, wie weit man es mit dem moralischen Relativismus treiben will –, so doch zumindest erklären und in einen geschichtlichen Kontext stellen. Die Geschichte der letzten Jahrhunderte, insbesondere der letzten hundertundfünfzig Jahre, wäre dafür sehr aufschlussreich. Ich werde mich auf die drei den Nationalpark unmittelbar angrenzenden Länder beschränken: Uganda, die sogenannte Demokratische Republik Kongo, ehemals Zaire, und Ruanda. Es fällt mir schwer, diese drei Länder zu bewerten, weil ich – ehrlich gesagt – nicht weiß, welches am schlimmsten dran ist, welches die schlimmste Vergangenheit erlitten hat oder welches am schlimmsten ausgebeutet worden ist. Ich behandle sie daher in alphabetischer Reihenfolge: Ruanda, Uganda und Zaire, auch wenn Zaire sich seit seiner sogenannten Unabhängigkeit nicht mehr so nennen mag. (empfindliche Gemüter überspringen besser die nächsten sechs Seiten, sie enthalten ausschließlich Mord und Totschlag der widerlichsten Art, sie stellen sogar arabis’ Umgang mit den chinesischen Tierhändlern in den Schatten).
Also, an erster Stelle Ruanda: In Ruanda war die Situation grausam, wie die Augen zu Genüge beobachten konnten. Das Trauma dieses Landes ist hinreichend bekannt, man muss wenig dazu sagen: Achthunderttausend tote Tutsi und dissidente Hutu, zwischen dem 7. April und Juni 1994 von radikalen, aufgestachelten Hutu umgebracht, und wir alle wissen, welche Rolle dabei Frankreich und Belgien durch Unterlassung gespielt haben, wie die USA unter dem Schock der kurz zuvor erlittenen Verluste in Mogadischu sich nicht traute zu intervenieren, wie die UNO versagte. Es waren täglich zehntausend Tote zu beklagen, drei Monate lang. Ein Völkermord mit Macheten, reine Handarbeit. Bis zum Schluss gab es in den Nachbarländern Ruandas Flüchtlingslager. Dort wohnten ehemalige Täter, diese nannten ihre Lager „Exil“, und ehemalige Opfer, diese wiederum nannten ihre Lager „Vertreibung“.
Eine der vielen Gruppen und Clans wurde von einem illuminierten Spinner geleitet, Seine Hoheit, Feldkommandant Generalleutnant der Hohen Übergangsautorität, Lebenslänglicher Anführer der Behörde des Rechten Pfades, Wonne der Sonne und Licht unseres Landes, Merengé Mkurunu. Eine elegante, hagere, gut gekleidete Gestalt, die in der Regel Manschettenknöpfe und manchmal sogar Gamaschen zum teuren Zweireiher trug, er hatte immer einen Stock mit einem silbernen Knauf in der Gestalt eines Adlerkopfes bei sich, obwohl er nicht hinkte. Manche sagen, damit hätte er viele Schädel eingeschlagen und Jungfrauen geschändet. Einer seiner vielen Erlasse verbot die Benutzung eines Fahrrads, ob er dies aus wahnwitzigen religiösen Gründen verkündete oder um die Bewegungen der Menschen unter seinem Regime besser kontrollieren zu können oder einfach aus Bosheit, wird sein Geheimnis bleiben.
Ein älterer Mann hatte kurz nach Verkündung dieses Erlasses das Pech, von einer Patrouille Merengé Mkurunus beim Fahrradfahren erwischt zu werden. Die Strafe war bekannt: Sein Bein sollte abgehackt werden. Wir filmten das Spektakel aus hundert Metern Höhe und verpassten keine Details. Zwei Milizionäre der Soldateska, ein alter Mann auf dem Boden, neben ihm sein Fahrrad. Eine Frau kam des Weges. Als sie merkte, in welch gefährliche Situation sie hineingeraten war, war es zu spät umzukehren. Die Soldaten packten sie, warfen sie neben den alten Mann auf den Boden. Daraufhin zwangen sie sie unter vorgehaltener Waffe, das Bein des alten Mannes abzubeißen. Der Mann schrie und wehrte sich, also wurde er geschlagen, bis er sich nicht mehr rührte. Die Frau biss und biss, ihr Gesicht war blutverschmiert, ihre Augen bekamen einen irren Ausdruck. Wie verängstigt muss man sein, um einen solchen Befehl zu befolgen? Sie stand unter Schock, natürlich, in Todesangst. Ich habe die beiden Männer gesehen, die sie bedrohten; ich bin mir sicher, sie hätten keine Sekunde gezögert, sie grausam und langsam zu Tode zu foltern. Was soll man da machen? Ich will es mir nicht ausmalen. Erst als sie beim Knochen angekommen war, gab man ihr eine Axt, damit sie mit dieser das Werk vollenden konnte. Die Frau konnte jedoch nicht mehr aufstehen, sie war zu keiner Regung mehr fähig und lag benommen neben dem verkrüppelten Mann. Einer der beiden Soldaten nahm die Axt und durchtrennte den Knochen, einhändig, beinahe lässig. Der alte Mann blieb auf dem Boden liegen, sein Bein neben sich, und verblutete bewusstlos. Die Frau blieb ebenfalls liegen, von Krämpfen geschüttelt. Die Soldaten zogen davon, lachend, das Fahrrad mit sich schleppend. Sie erschossen die Frau nicht, vermutlich war sie wertvoller für sie, wenn sie diese Geschichte verbreitete.ii Dann nahm einer der beiden sein Telefon, scheinbar hatte es geklingelt, denn er redete sofort los, ohne vorher gewählt zu haben. Irgendjemand teilte den beiden mit, dass sie bei ihrer heldenhaften Aktion gefilmt worden waren, denn sie schauten zur Sonne, in Richtung unseres Auges. Unsere User hatten die Anweisung, soweit möglich oder sinnvoll, das Geschehen, das sie interessierte, von der Sonne aus zu beobachten, das heißt, sie sollten sich so positionieren, dass der Gefilmte der Sonne entgegenschauen musste, um das Auge zu entdecken, was eine ziemlich gute Tarnung gewährleistet und die optimale Beleuchtung erleichtert. Die beiden Soldaten versuchten, das Auge im grellen Gegenlicht auszumachen, sie schützten ihre Augen mit der Hand und nahmen ihre Maschinengewehre von der Schulter. Das Auge flog zurück und vergrößerte die Zoomstufe. Wir waren nun über 150 Meter entfernt. Sie schossen in etwa in unsere Richtung, aber man sah sofort, wie schlecht sie ausgebildet waren: Sie schlossen beim Schiessen die Augen, auf diese Entfernung würden sie nur einen Glückstreffer landen. Das Auge wurde weiter von ihnen weggeführt und nahm Fahrt auf. Die beiden Männer wurden immer kleiner, ihre Schüsse trafen das Auge nicht. Später halfen unsere Bilder, die zwei Soldaten zu identifizieren, aber sie wurden nicht verurteilt, sondern in einem Racheakt umgebracht. Tribal business halt…
Das erinnerte mich an eine Episode, über die der große polnische Reporter Ryszard Kapuściński berichtete. Auch er war in dieser Gegend unterwegs gewesen, wie immer allein. Er besuchte den lokalen Arzt, Herrn Doktor Ranke, der gegen das Leiden der einfachen Bevölkerung Herrn Kapuścińskis Darstellung nach unermüdlich ankämpfte. Als er in der Stadt Ligali in einer kleinen Gasse zwei Soldaten auf sich zukommen sieht, weiß er, dass fliehen sinnlos ist. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet: Jeder der beiden trägt eine Maschinenpistole, Handgranaten, ein Messer, eine Panzerfaust, einen Knüppel, ein Feldgeschirr, Munitionsgürtel um die Schultern und um die Hüfte und Sturmriemen, an denen Karabinerhaken, Ringe und Klammern hängen. Es ist heiß, stickig, er ist allein, niemand wird ihm helfen. Er kennt diese Soldaten nicht, aber er kennt ihre Art. Er ist ihnen ausgeliefert, er weiß es, und er denkt an die Jahrhunderte der Unterdrückung, die die Vorfahren der beiden Soldaten erlitten haben, und an die Erzählungen, die sie seit ihrer Kindheit gehört haben müssen – Erzählungen der Erniedrigung, der Entwurzelung, der Gewalt, der Unterdrückung durch den weissen Mann. Als sie sich gegenüberstehen, allein in der Hitze der kleinen Stadt, bleiben sie stehen. Dann spricht einer der beiden Soldaten und seine Stimme klingt demütig, ja bittend:
„Monsieur, avez-vous une cigarette, s’il-vous plaît?“iii
Natürlich gab er ihnen seine Zigaretten, die ganze Packung sollten sie haben. Er wusste damals schon, unmittelbar nach der Unabhängigkeit des Landes, welches Glück er gehabt hatte in Anbetracht dieses Zweimanntribunals der höheren Gewalt ohne Revisionsinstanz. War das Glück früher häufiger anzutreffen oder verklären wir zunehmend die Vergangenheit? Oder ist unsere Verklärung der gelesenen Vergangenheit eine logische Verzerrung, die dadurch zustande kommt, dass es mehr Berichte von den Überlebenden gibt als von den Toten – aus dem einfachen Grund, dass die Toten nichts mehr berichten können? Ich weiß es nicht, aber mein Eindruck ist, die Lage wurde im Laufe der Zeit tatsächlich unentwegt schlimmer. Wie weit die Handlungen und Reaktionen der Menschen gehen können, werden wir bald sehen.
Dann käme Uganda: Uganda wurde von Sir Winston Churchill die „Perle Afrikas“ genannt. Das sagte er zu einer Zeit, in der Uganda Teil des Imperiums Ihrer Majestät war. Es muss ein wirklich schönes Land gewesen sein, aber zuerst die Kolonialpolitik des Vereinigten Königreichs, nachfolgend die Blutherrschaft Idi Amin Dadas (Milton Obote, vor und nach Idi Amin Dada Premierminister, war auch nicht unschuldig) und verschiedene Rebellionen, Grenzkonflikte, Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, meistens während der Zeit der Kolonialherrschaft künstlich aufgestachelt (das hatten alle drei Länder gemeinsam, und nicht nur die), und anschließend von interessierten Parteien instrumentalisiert, die Kämpfe zwischen der Mafia in ihren verschiedenen Ausformungen und zwischen Schmugglern, Aufständischen, Putschisten und dergleichen Gesocks mehr haben das Leben in der Perle Afrikas zur Hölle gemacht. Hunger und Krankheit, zum Teil Folge, zum Teil Ursache der Probleme, haben die Lage nur verschlimmert. Das auf die Spitze getriebene Grauen hat einen Namen: Joseph Kony, Anführer der LRA, der Lord’s Resistance Army (was sich mit „Widerstandsarmee des Herrn“ übersetzen ließe – leider klingt das auf Deutsch noch bescheuerter als auf Englisch und gibt somit nicht im Ansatz wieder, um was für eine mörderische Truppe es sich dabei handelte). Er sollte in Kürze das Vorbild für Hunderttausende auf der ganzen Welt werden, aber dazu später mehr. Hier nur einige belegte Beispiele seiner und seiner Schergen Brutalität:
Die LRA hatte die Angewohnheit (sie nannten es Taktik), isoliert gelegene, wehrlose Siedlungen zu überfallen. Dabei wurden regelmäßig die Männer getötet, die Kinder entführt, um sie zu Soldaten auszubilden, sofern man das, was sie dabei lernten, Ausbildung nennen darf, und die Frauen geraubt, um sie zu vergewaltigen. Letzteres wiederholt, ausdauernd und lange. Wenn die Frauen „verbraucht“ waren, ließ man sie liegen, wo sie waren: in der Regel starben sie ohnehin bald, oder, wenn man sich gnädig fühlte und eine Patrone verschwenden wollte, tötete man sie gezielt. Da die HIV-Rate unter den Soldaten (irgendwie muss man die Meute nennen, echte Soldaten mögen mir verzeihen) zu den höchsten der Welt zählte, waren die Tage der Sexsklavinnen ohnehin gezählt; das gezielte Töten war bei der Verrohung dieser Menschen das Naheste, was sie der Empfindung des Mitgefühls kommen konnten. Mehr waren sie nicht in der Lage zu zeigen, mehr besaßen sie einfach nicht. Was seine Gründe, Ursachen und Motive hatte, sie waren nicht derart abgestumpft zur Welt gekommen. Die meisten Männer waren Kinder gewesen, als man sie entführte, so wie die Kinder, die sie heute selber entführten. Manchmal flogen Augen in der Nähe, dann gab es Zeugen. Sonst nicht. Zum Beispiel sahen wir – und mit uns konnte es jeder sehen, der daran interessiert war –, dass eine bewaffnete Gruppe wieder ein Dorf überfallen hatte. Sie hatten zahlreiche Kinder und Frauen entführt, die Männer waren geflohen, sofern sie es geschafft hatten, oder tot. Die Mädchen wurden auf die Stützpunkte der LRA in den Südsudan gebracht, die Frauen vor Ort zu Tode missbraucht. Eines Morgens geriet die militärische Führung in Aufruhr: Aus ihren Gesten ließ sich schließen, dass ein Mädchen geflohen war. Die Tonqualität war, wie leider häufig, nicht gut, die Sprache wäre mir ohnehin unverständlich gewesen, Dolmetscher für exotische zentralafrikanische Sprachen und Dialekte waren selten. Allerdings sprachen die Handbewegungen der führenden Offiziere für sich. Die kleinen Mädchen verstanden diese Gesten, Drohungen, sehr wohl: Sie kauerten auf dem Boden, versuchten, sich zu schützen. Es half nicht, sie wurden geschlagen. Schließlich wurde das entflohene Mädchen gefunden, es hatte sich ganz in der Nähe versteckt. Sie wurde geschlagen, die Kleider wurden ihr vom Leib gerissen. Dann – und das zeigt die durchdachte Grausamkeit der Milizen – mussten die anderen Mädchen sie schlagen. Da diese nicht fest genug schlugen, sie waren noch nicht gebrochen und verroht, wurden sie selber mit Stöcken und Gewehrkolben traktiert. Man befahl den Mädchen, erneut und vor allem fester zuzuschlagen. Natürlich taten sie es nun. Das kurzfristig geflüchtete Mädchen war blutüberströmt und zitterte am ganzen Leib. Die anderen Mädchen versuchten, sie dort zu schlagen, wo es keine schweren Schäden verursachen würde, an den Beinen etwa. Die Schergen waren mit dem Geschehen nicht zufrieden. Die Mädchen mussten sich schließlich in einer Reihe aufstellen und die Geflohene so lange einzeln schlagen, bis der Kommandant (später erfuhren wir, dass er Lagira hieß) zufrieden war. Es folgte die nächste, und die nächste, und die nächste… Das geflohene Mädchen war chancenlos. Am Ende kam der Kommandant erneut auf sie zu und schlug ihr mit einem Stock ein letztes Mal auf den Kopf, mit aller Kraft. Sie war endlich tot.iv
Dieses Vorgehen hatte Methode. Ziel war es, die Mädchen zu entmenschlichen und gefügig zu machen. Sie sollten gebrochen werden und sie wurden es. Sie sollten selber zu Kämpferinnen werden, jeden Befehl bedenkenlos ausführen. Neue Gefangene wurden einem solchen Schock stets innerhalb der ersten 24 Stunden ihrer Gefangenschaft ausgesetzt. Die Methode funktionierte immer. Leider sind auf diese Art gebrochene Menschen, zumal sie danach häufig jahrelang in Kampfhandlungen verwickelt sind, nur mit einer aufwendigen und weitgehend aussichtslosen Therapie wieder gesellschaftsfähig zu machen. Uganda verfügte weder über die Therapeuten, noch die Ressourcen, noch die Zeit und schon gar nicht die Geduld, diese Opfer, die selber zu Tätern gemacht worden waren, zu unterstützen. Das Land versank im Chaos. Das alles sahen die Augen.
Zu guter Letzt gibt es noch die irrwitzig getaufte Demokratische Republik Kongo.v Welch ein Oxymoron! Nichts an dieser Bezeichnung stimmte! Wie weit in die Vergangenheit muss man zurückgehen, um das Drama und das Elend dieses Landabschnittes in die richtige Perspektive zu rücken? Zurück bis zu den letzten Bürgerkriegen mit acht Millionen Toten? Oder die beiden Bürgerkriege zuvor, die zwischen 1996 und 1997 und – unmittelbar im Anschluss – die zwischen 1998 und 2003, mit fünf Millionen Toten? Das war der tödlichste Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg und er blieb es auch bis zum nächsten Krieg in derselben Gegend nur wenige viele Jahre später. Oder sollte man zurückblicken bis zu den Tagen der Unabhängigkeit mit Joseph-Desiré Mobutu, der sich selber Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga nannte, eine Ansammlung von Titeln, die im Original dermaßen aberwitzig sein muss, dass ein Dutzend Übersetzungen davon kursieren, eine lächerlicher als die andere? Er war der Kleptokrat mit der Leopardenfellmütze: Jackie Kennedy besaß ebenfalls so eine, aber ihr stand sie besser. Wenn man heute seinen Namen im Internet recherchiert, taucht mit schöner Regelmäßigkeit ein Foto von einem Treffen zwischen ihm und dem amerikanischen Präsident Nixon auf. Auf dem Foto scheinen sie sich zu mögen. Oder sollte man sich die Tage der belgischen Kolonialherrschaft zurück ins Gedächtnis rufen, als es König Leopold schaffte, das Land von der Gemeinschaft der Nationen als privates Territorium übertragen zu bekommen, damit er – als guter Katholik – es anständig führte? Seine Habgier und die Morde, die in seinem Namen durchgeführt wurden, sind legendär… Oder sollten wir doch lieber auf die Zeit der portugiesischen Eroberer im 15. und 16. Jahrhundert zurückgehen, die auf sehr christliche Art und Weise das Land nach Sklaven durchsuchten, die Stämme gegeneinander aufwiegelten und auf ewig anfeinden ließen? Braucht es wirklich noch mehr konkrete Beispiele der sinnlosen Gewalt, um aufzuzeigen, welche Stimmung in dieser Gegend herrschte? Ich denke nicht, es macht kein Vergnügen. Die empfindlichen Naturen können ab hier beruhigt weiter lesen, mir ist nicht nach Details in einer solchen Angelegenheit zumute.
Die Probleme der Region schienen sich um den Virunga-Nationalpark herum zu kristallisieren. Überall Flüchtlinge, meist gruppen- oder stammesweise miteinander verfeindet. Sie nannten es wieder tribal business. Reiche Bodenschätze in der ganzen Umgebung: Gold, Diamanten, Coltan, Silber, Kobalt, Mangan, Zink, Zinn, Cadmium, Germanium und Beryllium. Alles, bis auf die Diamanten, haben wir in unseren Luftjachten verwertet, die Diamanten im Brillantschlifftrug meine geliebte Frau am Ehering. Ich weiß nicht, ob ihre Brillanten aus dieser Gegend kamen. Es wäre traurig, wenn dem so wäre, würde aber an der Tatsache, dass wir die anderen Mineralien, die wir aus dieser Gegend bezogen, dringend brauchten – wie alle anderen Unternehmen und Nationen, die ebenfalls Mineralien aus dieser Gegend bezogen – nicht das Geringste ändern. Diese Elemente und Verbindungen waren für den reibungslosen Betrieb der Hyperborea unerlässlich. High-Tech beruht auf einfachsten Rohstoffen, manche davon sind selten.
Wir haben uns gefragt, wer die Augen in der Region eigentlich lenkte. Das Ergebnis war nicht überraschend: Alle interessierten Gruppen taten es. Bei einem Scharmützel wurden die Daten von beiden Seiten genutzt, die Bahn der Augen von beiden beeinflusst, was dementsprechend zu erratischen Flugbahnen führte. Die neutralen Beobachter, Journalisten etwa, und die, die nur die Natur beobachteten, gaben dem System umso mehr Trägheit, je zahlreicher sie waren. Ähnliches gilt bei Grenzüberwachungen, bei Schmugglerverfolgungen, Warentransporten, Lagerüberwachungen… – zu jeder Zeit schauten Räuber und Gendarm gleichzeitig zu. Nur arabis schien bei dem Chaos nichts unternehmen zu wollen; kaum einer der User, die wir mit denen in Verbindung gebracht hatten, schaute jemals in dieser Gegend vorbei. Entweder waren ihnen die Menschen egal (so mein Verdacht) oder sie stellten einen völlig autonomen Block dar, den wir im Hintergrundrauschen der anderen User nicht identifiziert hatten. Sie unternahmen jedenfalls nichts in dieser Gegend. Stattdessen rottete jemand die Berggorillas aus – folgendermaßen:
Berggorillas sind soziale Tiere, sie leben in kleinen Gruppen unter der Führung eines erwachsenen Männchens, aufgrund seiner Fellfärbung „Silberrücken“ genannt. Zu einer Gruppe gehören ferner einige geschlechtsreife Weibchen und deren Nachkommen. Die männlichen Nachkommen verlassen die Gruppe, sobald sie geschlechtsreif sind: Sie werden vom anführenden Silberrücken vertrieben. Sie leben eine Zeit lang einzeln im Regenwald, bis sie eine eigene Gruppe gründen oder übernehmen können. Die meisten weiblichen Nachkommen wechseln mit der Geschlechtsreife ebenfalls die Gruppe, das verringert die Inzuchtgefahr. Im Virunga-Nationalpark gab es zuletzt fünf Gruppen mit mehr als sechzehn Mitgliedern, dreiundzwanzig Gruppen mit bis zu fünfzehn Mitgliedern und etwa zwanzig einsame Männchen. Einsame Weibchen kamen nicht vor. Drei Viertel des Bestandes waren mit dem Menschen und seiner Anwesenheit vertraut, die Gorillas hatten sich zwangsweise an Touristen, Ranger und Einheimische gewöhnt, ein Viertel war menschenscheu und ließ sich selten blicken. Daraus konnte die letztgenannte Gruppe jedoch leider keinen Nutzen ziehen, wie man im Folgenden sehen wird.
Der Teil des Virunga-Parks, in dem die Berggorillas lebten, war recht klein, kaum fünfzig mal dreißig Kilometer groß, und hatte einen Umriss, der stark an Afrikas Silhouette erinnerte, einzig um neunzig Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dieser Bereich des Virunga-Parks lag zu einem kleinen Teil in Uganda, er hieß Mgahinga-Gorilla-Nationalpark. Hier lebten insgesamt keine vierzig Berggorillas mehr, sie waren nicht an Menschen gewöhnt. Der ruandische Teil des Parks nannte sich Volcanoes Nationalpark, in ihm befanden sich über die Hälfte der Berggorillas, von denen sich die meisten an die Anwesenheit des Menschen gewöhnt hatten. Der letzte und der Fläche nach größte Teil des Virunga-Parks befand sich in dem Gebiet der sogenannten Demokratischen Republik Kongo. Im südlichen Teil des kongolesischen Parks, dem Mikeno-Sektor, lebten zuletzt noch ungefähr dreihundert Berggorillas, von denen etwa die Hälfte die Anwesenheit des Menschen duldete, die andere Hälfte hingegen war menschenscheu. Der weitaus größte Teil des Virunga-Nationalparks auf kongolesischem Gebiet, der Nyamulagira-Sektor, war durch einen schmalen Korridor mit dem Bereich verbunden, in dem die Berggorillas überlebten. Der Nyamulagira-Sektor reichte bis zum Kivu-See im Westen und ging sehr weit nach Norden, wo er in andere Nationalparks überging, von denen der wichtigste und bekannteste wohl der Bwindi Impenetrable National Park sein dürfte. Hier hatte einst eine zweite Unterart der Berggorillas gelebt bis sich herausstellte, dass der Bwindi – entgegen seinem Namen – nicht undurchdringlich ist und die Bwindi-Gorillas von Wilderern ausgerottet wurden, bevor die Kontroverse geklärt werden konnte, ob es sich bei den Bwindi-Gorillas um eine Unterart der Berggorillas handelt oder ob beide Gruppen zu einer einzigen Spezies gehören. Nördlich des Bwindi Impenetrable National Parks verläuft der Äquator, den der Virunga-Nationalpark kreuzt.
Die Regierungen der drei Länder um den Virunga-Nationalpark versuchen seit Langem, die Anwesenheit des Menschen innerhalb des Parks auf ein Minimum zu reduzieren. Dieses Vorhaben klappt nur bedingt und es klappt besonders dann nicht, wenn die Kämpfe der Menschen untereinander wieder aufflammen. Rebellen flüchten in der Not gern in den Park, weil es dort nur wenige Menschen gibt, die für sie gefährlich werden können (sie bleiben allerdings nicht lange, denn die Kehrseite der Medaille ist, dass es entsprechend weniger Menschen gibt, die sie ausbeuten können). Umso größer ist der Druck an den Grenzen des Parks: Neue Siedlungen und Flüchtlingslager wachsen ohne Unterlass, ständig, überall. Die Stadt Goma, am Ufer des Kivu-Sees, hat bereits über eine Million Einwohner, die meisten davon IDPs, wie die Vereinten Nationen die Internally Displaced Persons euphemistisch nennt, also die Flüchtlinge im eigenen Land, die daher keinen Flüchtlingsstatus genießen. Das Völkerrecht schreibt vor, dass man eine internationale Grenze überqueren muss, um in den Genuss des Flüchtlingsstatus zu kommen. Demnach bekommen diesen Status nur die Flüchtlinge, die das eigene Land verlassen können, dürfen oder müssen. In Goma befindet sich das Hauptquartier der UN-Truppen in der Region, von dort aus starten sie ihre Patrouillen. In Richtung Nordwesten führt die einzige befestigte Straße der Umgebung vorbei an mehreren Flüchtlingslagern (Mugunga 1 und 2, Bushimba, Bulengo, Nzulo…) bis nach Sake, wo wiederum die kongolesische Armee ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. Weiter nördlich liegt das Hauptquartier der Tutsi-Miliz, östlich davon das der Hutu-Miliz. Von Goma aus in Richtung Norden verläuft eine unbefestigte Straße vorbei an die Ortschaft Kibumba (mit seinen ähnlich großen Flüchtlingslagern) hin zur Rumangabo Station, dem Hauptquartier der Virunga-Nationalpark-Verwaltung. Etliche Hundert Ranger sind in den letzten Jahren in Ausübung ihrer Tätigkeit erschossen worden, die Moral ist schlecht, die Bezahlung gering und unregelmäßig. Östlich der Rumangabo Station beherrscht wieder eine andere Tutsi-Miliz die Gegend.vi
Die Milizen, die lokalen Mafiabanden und die Warlords (so nennt man oft die lokalen Kriegstreiber) haben vor allem zwei Einnahmequellen: Mineralien, die sie von Sklaven abbauen lassen und im Westen und nach China verkaufen, und Holzkohle, die sie von Sklaven herstellen und transportieren lassen. Die Holzkohle, fünf Taler für einen großen Sack, verkaufen sie an die Einheimischen. Eine durchschnittliche Flüchtlingsfamilie braucht einen 150 Pfund schweren Sack Holzkohle im Monat, es leben in der Region Hunderttausende solcher Familien. Das Geschäft boomt und die Wälder gehen zur Neige. Das mindert die Einnahmen aus der einzigen langfristig tragbaren Tätigkeit, die in der Region noch möglich ist: Öko-Tourismus.
Man hat einiges versucht, um diesen Holzkohlehandel zu unterbinden. Selbst Augen mit Infrarotkameras wurden eingesetzt, mit deren Hilfe man nachts die Wärmestrahlung der aufgeschütteten Hügel entdecken wollte, in denen die Holzkohle erzeugt wird. Es half nichts und die Bevölkerung fühlte sich den Unterdrückern immer stärker ausgeliefert. Das Gefühl trog nicht. Der Rest der Welt machte sich Sorgen, sicher, vor allem jedoch um die Tiere im Virunga-Nationalpark und um die Ressourcen. Tolle Tiere! Waldelefanten, Waldschimpansen, Okapis, Nashörner, Giraffen und unzählige Vogelarten, um nur einige der größten und auffälligsten zu nennen. Dann kam eine Weile gar nichts, ganz am Schluß erst die Sorge der Weltgemeinschaft um die Einheimischen. Die Tutsi töteten Hutu (und moderate Tutsi), die Hutu rächten sich an den Tutsi (und an den moderaten Hutu), Soldaten bekämpften Milizen, Milizen bekämpften Ranger, Ranger bekämpften Schmuggler und die Schmuggler bekämpften die Soldaten. Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen saßen zwischen allen Stühlen und wurden von jedem bekämpft. Bis schließlich eine Gruppe in diesem fortwährenden Kampf ins Hintertreffen geriet und beinahe ausgelöscht wurde: Die Armee der Rebellen Seiner Congolesischen Hoheit (lustige Abkürzung haben die sich ausgedacht) stand mit dem Rücken zur Wand und ihr Anführer griff zum Äußersten, um die Aufmerksamkeit der Welt auf ihre desolate Lage zu lenken. In nur zwei Nächten tötete die arsch viele männliche und alle weiblichen Berggorillas im Park. Sie kannten das Gebiet gut, sie wussten, an welchen Stellen die Gorillas in ihren selbst gebauten Nestern schliefen, und ihnen standen Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras und Zielfernrohre zur Verfügung. Sie schnitten den toten Affen nicht die Hände, Füße und Köpfe ab, wie die Wilderer es taten, die diese Trophäen verkauften. Sie aßen auch nicht wie sonst üblich das Fleisch der Berggorillas, unter den Einheimischen sonst als Spezialität gehandelt.vii Die Operation sollte schnell und gründlich verlaufen und in diesem Sinne war sie erfolgreich. Groß war daraufhin das Jammern derer, die sich betroffen fühlten. Groß war auch die Häme, mit der sich die Täter zu ihrer Tat bekannten. Sie lachten über die männlichen Berggorillas, die sich ohne Weibchen nicht mehr vermehren konnten. Sie machten sich über die Gorillababys lustig, die sich an ihren toten Müttern festklammerten, aber keine Milch, keine Wärme und keine Streicheleinheiten mehr bekamen. Vor allem lachten sie über die Menschen, denen die Natur wichtiger war, als sie es selber jemals sein würden. Menschen wie wir. Einige Auszüge ihrer Bekennerschreiben des arsch-Pressebeauftragten (sic!) Eugène Terre´Noire gefällig? Bitte:
„Wir haben es getan! Wolltet Ihr nicht unsere Natur retten? Sollten wir nicht verschwinden, damit wir Euch und Eure Tiere nicht stören? Jetzt könnt Ihr uns endlich helfen, die Tiere sind nicht mehr im Weg! Es waren niemals Eure Tiere! Die wenigen Männchen, die noch leben, haben keine Zukunft mehr. Sie sind wie Zombies, sie scheinen zu leben, sind aber schon tot; sie stehen noch, haben aber kein Leben mehr in sich!“
„Wir waren Euch nicht wichtig genug, wir zählten für Euch weniger als die Tiere. Ihr habt keinen Respekt für den Schwarzen Mann, aber der Schwarze Mann isst Eure Götzen auf. Letzten Monat starben fünfhundert unserer Kämpfer. Niemand interessierte es. In nur zwei Nächten haben wir jetzt die Weibchen Eurer Fetische ausgelöscht. Das wird erst der Anfang sein. Wir werden weiter für unsere Freiheit, unsere Ehre und unsere Würde kämpfen, wir werden mit Gottes Hilfe einen festen Platz in diesem Land erkämpfen, wie wir es unseren Vorfahren schulden, wie wir es unseren Kindern versprochen haben. Unser Feind wird kein Pardon kennen und unser Feind sind alle, die nicht auf unserer Seite stehen.“
So ging es Seite um Seite weiter. arabis schwor Rache, der WWF war konsterniert, die Presse weltweit tobte, internationale Geldgeber drehten den Geldhahn zu, die UNESCO veranstaltete einen Champagnerempfang in ihrem Hauptquartier in Paris, weil dafür noch ein Budgetposten unverbraucht war, er wäre sonst verfallen, welch ein Jammer! Die Kämpfe am Kivu-See wurden erbitterter geführt als je zuvor. Die Täter von der arsch waren bereits zuvor am Rande der Vernichtung gewesen, die anderen Kämpfer und Rebellen der Region beschuldigten sie, ihren Ruf – ja, so nannten sie es, ihren Ruf! – zu verunglimpfen und schlugen hart zu. Da sie schon dabei waren, mordeten sie sich verstärkt gegenseitig, entführten noch mehr fremde Kinder (immer wieder Kinder, natürlich, daher stammt seit der Antike der Begriff „Infanterie“: Kinder sind die besten Soldaten für den skrupellosesten Führer) und vergewaltigten noch mehr Frauen.
Wir waren genauso geschockt wie die meisten Menschen, die vor ihren Monitoren das Geschehen verfolgten. Frust schlug in Hass und Häme um und die Weltgemeinschaft, die angebliche, die sogenannte, kriegte es jetzt zu spät mit. Es war niederschmetternd.
„Diese armen Gorillas erinnern mich an die traurige Geschichte des südafrikanischen Palmfarns in den Royal Botanic Gardens in Kew. Er gilt in der freien Wildbahn als ausgerottet und in den Gärten kommt er nur in seiner männlichen Variante vor, alles Ableger derselben Pflanze. Der einzige Sex, den diese Spezies im letzten Jahrhundert gehabt hat, bestand darin, sich Stücke vom eigenen Körper abschneiden zu lassen, die anschließend als Setzlinge wieder eingepflanzt wurden“viii, sagte Sven Maven, die Hände in den Hosentaschen, finster auf den Monitor blickend. „Wenn man das als Sex bezeichnen kann.“
„Voll schwuler Sado-Maso-Sex“, meinte Ali dazu, subtil differenziert. „Mich erinnert es an die Geschichte der Ents aus ‚Herr der Ringe‛. Die Ents gehören zu den ältesten Lebewesen Mittelerdes, sprechende Bäume eines vergangenen Zeitalters. Die Entweibchen sind verschollen, keiner weiß genau, wann und wie, so lange ist ihr Verschwinden her.“
„Du hast ein Buch gelesen?“ Beata tat boshaft erstaunt. Sie war so mitgenommen, dass sie ohne nachzudenken redete. Ich fürchtete, sie verriet gerade mehr über ihre Gedanken, als ihr lieb sein konnte. Ich tat, als ob ich nichts bemerkte, ganz ahnungslos.
„Ich habe den Film gesehen“, antwortete Ali arglos. Aber Beata Maloumie hörte ihm nicht mehr zu.
„Dafür werden sie büßen!”, sagte sie leise mit zusammengebissenen Zähnen. Ich hoffe, sie meint damit die Richtigen. Ich sah bei ihr denselben Frust, der in Hass umschlägt wie bei den Schergen der arsch. Wenn man nichts mehr machen kann, neigt man dazu, irrational zu werden. Ich hatte den Eindruck, Beata könnte blind um sich schlagen ohne Rücksicht auf Verluste. Nach einer Weile redete sie weiter:
„Genau wie bei den Saigas, nur andersherum.“
„Wie bei wem?“, fragte Ali sogleich nach. Beata schaute ihn an und seufzte, als ob sie ihre Geduld erst sammeln müsste. Nach einer kurzen affektiert-theatralischen Pause sagte sie:
„Saigas sind eine Art Antilope, die in Asien lebte. Einige Ökos haben in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts vorgeschlagen, die Anhänger der traditionellen chinesischen Medizin mögen auf die Hörner der Saigas ausweichen, um die Nashornbestände nicht auszurotten. Der Hinweis hatte zur Folge, dass sie die männlichen Saigas ausrotteten, denn nur sie trugen Hörner. Zuletzt gab es Zehntausende notgeiler Weibchen, aber keine Männchen mehr, um sie zu begatten.“
„Warum sollte man ausgerechnet mit Saigas die Nashörner retten?“, fragte Sven Maven, scheinbar interessiert.
„Wenn ich es richtig verstanden habe, unterscheiden die Anhänger der traditionellen chinesischen Medizin bei ihren Rezepten zwischen heißen, warmen, kalten, kühlen und neutralen Zutaten auf der einen Seite und süßen, sauren, bitteren, würzigen und salzigen auf der anderen. Daraus ergeben sich einige Kombinationen – fünfundzwanzig, wenn ich richtig rechne, sofern die Abgrenzung zwischen den Kategorien klar ist, oder beliebig viele, sofern die Grenzen fließend sind – und die Anhänger waren der Meinung, mit der richtig kombinierten Medizin könnte man das Ungleichgewicht zwischen Yin und Yang im Körper eines Patienten wiederherstellen.ix Rhinohörner stellten diesem Schema zufolge eine salzige, kühle Medizin dar, ebenso Saigahörner,x daher zog jemand die Schlussfolgerung, wenn man die Chinesen davon überzeugen könnte, Saigas statt Rhinos als Aphrodisiakum zu verwenden, würde man die Rhinos retten. Das war wohl zu kurz gedacht. Stattdessen verurteilte man die Saigas zum Tode und was aus den Rhinos wurde, brauche ich nicht zu erläutern.“
„Gab es denn nur so wenige von ihnen? Warum hat man dann gerade sie als Alternative auserkoren?“, bohrte Sven Maven nach.
„Nein, es gab um die Jahrhundertwende reichlich Saigas, geschätzte zwei Millionen. Am Ende des Ersten Weltkrieges waren sie schon einmal stark gefährdet gewesen, dennoch hatte sich deren Bestand in den Fünfzigern gut erholt, so dass die Behörden die Jagd wieder freigaben. Zunächst lohnte sich die Jagd kaum, aber nachdem die Chinesen Interesse zeigten, haben sich die Wilderer gefreut, weil die Saigas plötzlich doch etwas wert waren. Zu der Zeit brach die Sowjetunion auseinander und die neuen Länder Zentralasiens hatten andere Sorgen, als sich um den Umweltschutz zu kümmern. China war ein direkter Nachbar und zahlte gut. Die Saigamännchen wurden gnadenlos gejagt, die Weibchen meist in Frieden gelassen. Am Ende haben einige Naturschützer versucht, mit einer Handvoll Männchen, die sie im Kölner Zoo in Gefangenschaft hielten, die Weibchen künstlich zu befruchten, aber es funktionierte nicht. Übrigens sind Saigas leicht zu zähmen, man hätte sie durchaus züchten können.“ Sie klang wieder verbittert. Die Unterhaltung war für mich beendet, ich wendete mich ab und ging.
Die Gegend um den Virunga-Nationalpark kam erst zur Ruhe, als arabis die angekündigte Rache wahr werden ließ. Sie sollte grausam sein, es wurde eine Friedhofsruhe. Die Rache war so grausam, dass sogar die meisten Tiere in der Gegend starben. Bis dahin würde es noch drei Jahre dauern, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir hören später davon. Versprochen. Aber vorher passiert noch allerhand.