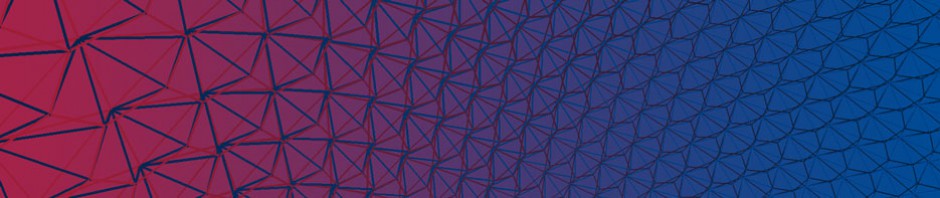Überall auf der Welt gab es Mauern und Zäune. Zäune bestanden aus Draht oder Stacheldraht und verrosteten langsam, selbst die verzinkten. Zink wäscht sich aus, vor allem wenn der Regen sauer ist. Aber noch steht sehr viel Draht und Stacheldraht herum, manchmal, zum Beispiel an ehemaligen Grenzen, auf vermintem Gebiet. Oft hängen an den Stacheln Fetzen aus Stoff oder aus Plastik und wehen im Wind, ähnlich wie die sibirischen Urvölker früher Bäume mit Fetzen behängt haben, um das Glück zu beschwören. Es sieht schon befremdlich aus. Häufig sind die Zäune von Ranken überwachsen, in dem Falle sieht man sie von oben nicht, aber sie teilen das Land dennoch in für viele Tierarten unüberwindliche Parzellen ein.
Die Mauern, von denen es in England, auf der Iberischen Halbinsel und im Nordosten der ehemaligen USA, um nur drei von unzähligen Beispielen zu nennen, Tausende von Kilometern gab, hielten den Elementen gut stand. Sogar auf den relativ kleinen Azoren fanden sich Mauern ohne Ende. Die zumeist trocken verputzten Steinmauern waren entstanden, indem die Felder, die früher steinig gewesen waren, über Generationen per Hand von ebendiesen Steinen gereinigt worden sind. Wenn der Besitzer eines Feldes einen Stein sah, nahm er ihn auf und stellte ihn an den Rand seines Grundstücks. Wenn es sich ergab, ließ der Besitzer diese Tätigkeit natürlich von Angestellten oder Sklaven verrichten, das war bequemer. Die Steine am Rande des Grundstücks, das war nicht schwer zu lernen, bildeten selbst ohne Mörtel eine stabile Mauer, sofern man sie ordentlich schichtete. Die Mauern werden lange halten, eher werden sie von Humus überwachsen, besonders an der dem Wind zugewandten Seite, wo sich Laub ansammelt und kompostiert, als dass sie einstürzen. Die spanischen Stiere, Nachkommen der Tiere, die einst für den Stierkampf gezüchtet wurden, die schottischen langhaarigen Angusrinder, die sich fünf Jahre nach Apophis auf der gesamten Insel Großbritannien verbreitet zu haben schienen, und die Langhorn-Rinder in den USA vermittelten den Eindruck, sich in dieser Landschaft wohlzufühlen. Fressfeinde hatten sie offenbar kaum. Ich frage mich, welche Art oder Arten von Tieren diese evolutionäre Chance wahrnehmen werden. Bei dem Potpourri an Raubtieren, die weltweit aus Zoos entkommen sind, stehen alle Möglichkeiten offen. Die genetische Basis aller möglichen Kandidaten ist dünn, aber von oben herab sieht es so aus, als ob Raubtiere einige Generationen lang eine hervorragende Chance hätten, ihre Nachkommen durchzubringen. Katzen gelingt das schon auf vielen Inseln, die sind vielleicht zu erfolgreich: Eine Spezies, die auf lange Sicht die eigene Nahrungsgrundlage vernichtet, ist evolutionär im Nachteil. Sie sollten diesbezüglich uns Menschen fragen, wenn sie auch nur einen Funken Verstand haben, so lange meine geliebte Frau und ich noch über die Welt schweben. Sie haben aber keinen Verstand und wenn man bedenkt, dass selbst wir, mit unserem angeblichen Verstand uns derart irrational verhalten haben, ist es um die Katzen auf kleinen Inseln nicht schade. Um die Ratten sowieso nicht, wer mag schon Ratten? Als ob sie das interessieren würde: Ratten werden vermutlich überall überleben, selbst auf den kleinsten Inseln. In großen Gebieten werden die Katzen fortbestehen und sich weiterentwickeln. Manche werden wachsen, andere werden langhaariger werden, wiederum andere werden sogar lernen, wie man schwimmt. Angeblich waren dazu bereits türkische Katzen in der Lage. In anderen Gegenden haben obendrein Luchse und noch größere Katzen, Wölfe, andere Kaniden und Hyänen und hier und da selbst Bären eine Chance. Viel Glück. In Indien gibt es noch (oder wieder?) Tiger, die zudem schwimmen können, wie in Süd- und Mittelamerika die Jaguare. Die Zebus tun ihr Bestes, um nicht gefressen zu werden, immerhin gibt es in Indien kaum Zäune oder Mauern, die Gebiete von anderen abschneiden und Subpopulationen voneinander isolieren. Wir sehen andauernd kleine Gruppen von Elefanten, in Europa, Nordamerika, Südostasien und natürlich in Afrika, wo ich allerdings nicht gern hinfliegen mag. Wo die wohl alle ausgebrochen sind? Kamen sie aus den Zoos oder Zirkussen? Gehen sie vielleicht wieder auf das Konto von ARABIS, mit oder ohne Beatas Zutun? Es existieren sicher weitere Tiere, aber die meisten sind kleiner als Elefanten, daher nicht so leicht von oben auszumachen; zudem verstecken sich viele Tiere, vor allem tagsüber. Das ist verständlich.
Einige Monate lang habe ich mir einen Spaß daraus gemacht, Koalas aus den Eukalypten Australiens von der Gondel der Hyperborea aus zu fangen, um sie kurze Zeit später in den verschiedenen Eukalyptuswäldern Europas, Afrikas (nur gelegentlich, ich überfliege Afrika, wie bereits erwähnt, ungern. Dennoch: Addis Abbeba hat zu viele Eukalypten, die Auswilderung ist mir ein Versuch wert) und Amerikas auszusetzen. Koalas sind so langsam und träge, die schlafen um die achtzehn Stunden am Tag, sie einzufangen, war ein Kinderspiel. Ihre Trägheit, lese ich bei Deep Doubt nach, kommt daher, dass ihre Nahrung, Eukalyptusblätter, extrem nährstoffarm ist. Koalas sind die Faultiere unter den Beuteltieren, nur niedlicher, sie schlafen sogar noch länger als diese. Ich dachte mir dabei, wenn die Papierindustrie schon diesen schnell wachsenden Baum mit seinen giftigen Blättern, auf dem so wenige Insekten leben, weltweit angepflanzt hat, sollte man gleichermaßen die zu diesem Ökotop gehörenden Tiere nachreichen. Mir war leider nicht bewusst, dass nicht alle Eukalypten gleich sind und dass Koalas nur einige Arten davon verzehren. Von meinen Koalas starben viele, aber nicht alle. Die Population mancher Kolonien scheint bis heute stabil zu sein. Ich ließ dennoch recht bald mein privates Beuteltier-Verbreitungs- und Auswilderungsprogramm sein.
Die Eukalypten, die ursprünglich nur in Australien einschließlich Tasmanien und in Indonesien vorkamen, sind mittlerweile auf der ganzen Welt zu finden und haben sehr wenige Fressfeinde. Eukalyptusbäume sind giftig und schwer verdaulich, sie verbreiten sich überall. Sie enthalten zahlreiche Gifte, unter anderem Cineol, Monoterpene, Sesquiterpenole, Sesquiterpene, Monoterpenole, Monoterpenketone, Aldehyde und verschiedene Ester. Sie sind sehr feuerresistent, die Äste und das ölhaltige Laub, das sie abwerfen, fördern sogar die Waldbrände, die deren Samen erst zum Keimen bringen. Die anderen Pflanzen gehen dabei ein, somit verbreiten sich die Eukalypten ungehindert. Nur wenige Insekten fressen diesen Giftcocktail und eben Koalas. Aber leicht haben sie es mit dieser Diät nicht: Eukalyptusblätter sind dermaßen nährstoffarm, dass sie nur mit Hilfe symbiotischer Bakterien verdaut werden können. Diese Bakterien nimmt das Koalajunge oral aus einer rektalen Ausscheidung der Mutter, dem Papp, auf, erst dann ist es in der Lage, nach und nach von der Milchnahrung auf die Blattnahrung der Erwachsenen umzuschwenken. Dann schlafen Koalas bis zu achtzehn Stunden am Tag, während die Blätter von den Bakterien für sie verdaut werden. So wenig Energie enthalten diese. Die Koalas sind zudem nur so intelligent, wie sie es in ihrer Nische zum Überleben brauchen, dass heißt, sie sind sehr schlicht. Diese magere Intelligenz reicht ihnen, jedenfalls in Australien. Man sollte sie entsprechend dort lassen, wo sie herkommen und hingehören. Woanders stehen ihre Chancen nicht gut. Aber wer soll dann die Eukalypten fressen?
Zwischen Schottland und England steht der Hadrianswall wie eine Mauer mit schrägen Seiten, an vielen Stellen sieht er mehr wie ein Damm aus als wie eine Mauer. Als dieser zu Beginn des zweiten Jahrhunderts unserer vergangenen Zeitrechnung gebaut wurde, markierte er die Grenze Roms zu den kaledonischen Barbaren des Nordens. Heute wird der Hadrianswall langsam von Pflanzen überwuchert.
Manche Mauern stehen senkrecht zur beherrschenden Windrichtung. An deren Luvseite sammelt sich Laub an, das nach und nach kompostiert und sich verfestigt. Im Laufe der Zeit kommt neues Laub hinzu, wieder und wieder. Größere Tiere können irgendwann über diese so entstandene Rampe klettern und die Mauer somit in eine Richtung überwinden, aber nicht in die andere, die unverändert steil in die Höhe ragt. Das ist dem Prinzip nach dieselbe Idee wie die trap door bei Computern – in eine Richtung einfach, in die entgegengesetzte unmöglich zu passieren. Kleinen Tieren sind Mauern egal: Sie klettern hinüber, krabbeln hindurch oder graben sich einen Gang darunter. Die Mauern wirken demzufolge wie Einbahnstrassen für die eine Spezies, aber nicht für die andere. An deren Leeseite, die sehr großflächig sein kann, konzentrieren sich nach und nach ausschließlich die kleinen Tiere, an der Luvseite finden sich die großen und die kleinen Tiere gleichermaßen. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass große Tiere vom Wind in eine Richtung getragen werden, kleine hingegen nicht. Das wird wohl so lange so bleiben, bis die Mauern zusammenbrechen oder bis sie von beiden Seiten gleichermaßen zu überspringen sind, wenn sich auf beiden Seiten ausreichend Erde aufgeschichtet hat.
Nachdem wir Beata Nalga dort, wo wir damals zufällig waren, ausgesetzt haben, reißt sie wie ein zorniges Kind im Affekt Zäune ein. Das war an sich eine schöne Idee, allerdings ist sie von einem einzelnen Menschen nicht zu bewältigen. Eher würden die Zäune rosten und zu Staub verfallen, als dass sie auch nur einen kleinen Teil der aufgestellten Zäune würde niederreißen können. Aber der eine oder andere Zaun steht unter Strom, der mitunter heute noch fließt, vermutlich von Solaranlagen oder Windkraftanlagen gespeist. Wenn man genau hinsieht, kann man beobachten, dass die Zäune unter Strom nicht rosten. Manche haben eine sehr geringe Spannung, wie die Zäune an den Kuhweiden, gegen die man als Kind auf die harte Tour gelernt hat, nicht zu pinkeln. Andere, wie die um den Air Force Stützpunkt in Colorado, stehen nach all den Jahren noch immer unter Hochspannung, selbst nachts. Die müssen nicht nur eine stromerzeugende Quelle haben, sondern auch einen funktionierenden Stromspeicher. Als Beata Nalga diesen Zaun berührt, ist sie tot. So weit war sie gekommen. Sie war die letzte Person, die wir mit den Augen lebendig verfolgten. Von Nicco Gassi fehlt jede Spur.
Im nördlichen europäischen Festland und auf den britischen Inseln gab es neben den Zäunen zahlreiche Hecken, die zunächst weiter wuchsen und ihre ursprüngliche Trennfunktion erfüllten, genau genommen sogar besser als ursprünglich, wenngleich nicht mehr so ansehnlich. Einige von ihnen gingen auf das Mittelalter zurück, die Sträucher waren teilweise Jahrhunderte alt und entsprechend knorrig. Nach und nach wuchsen sich die Hecken ohne menschliche Pflege zu kleinen Wäldern aus und bildeten ein eigenes Biotop. Bald wurden sie für kleinere Tiere durchlässig, danach für immer größeres Wild. Irgendwann, in einer nicht zu fernen Zukunft, würden sie Teil der natürlichen Landschaft werden und den menschlichen Einfluss allein dem aufmerksamen Auge verraten. Einige der Hecken brannten im Sommer aus, in diesem Fall blieben, von der Luft aus gesehen, eine Zeit lang schwarze Striche auf dem Boden.
zurück • vor