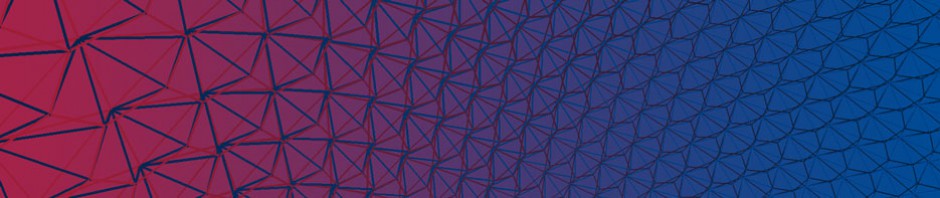Am 10. Dezember 2028, mitten in der verschwommenen Jahreszeit, in der altmodische Menschen wie Herr Klaasen, die noch Terminkalender aus Papier benutzen, zwei Kalender kombinieren und in der die Termine Gefahr laufen, sich zu verzetteln, am Tage der Verleihung des Friedensnobelpreises, dem hundertzweiunddreißigsten Todestag Alfred Nobels, ließen wir unsere erste Luftjacht los. Unser erstes Luftschiff, groß genug, um Menschen zu befördern. Wir hatten in der Zwischenzeit offiziell 20.354 Augen und 928 Vendobionten in der Luft. Wir behaupteten, ohne es wirklich belegen zu können, dass das der Anzahl der Atomsprengköpfe auf der Welt entsprach (wer weiß? Die Größenordnung zumindest stimmt), was wir bei der Lufttaufe nicht zu erwähnen vergaßen. Wir stellten uns als Gegengewicht dazu in Szene, was wohl etwas vermessen war. Unsere Moirai sollte eine Luftjacht des Friedens werden. Nicht die schlechteste PR, hoffentlich greift die Idee.
Die Formensprache der ersten Luftjacht, die Menschen bequem transportieren konnte, war klar und einfach wie die der Augen: in der Mitte ein Zylinder, vorn und hinten mit je einer Halbkugel abgerundet. Wir bauten sie aus denselben Elementen, mit denen wir die Vendobionten und das Sonnensystemmodell in der Chausseestraße herstellten: zu Sechs- und Fünfecken angeordnete gleichseitige Dreiecke, jedes mit einer Seitenlänge von zwei Metern, mit einer Grätzel-Zelle für die Stromerzeugung als bündige und luftdichte Abdeckung. Am Rand befanden sich dünne Streben aus NanoKohlenstoff-Faser, alle gleich dick, damit die Montage industriell in Serie erfolgen konnte, jedoch verschieden schwer und dementsprechend widerstandsfähig, je nachdem, an welcher Stelle des Luftschiffes sie zum Einsatz kamen und welchen Kräften sie demnach nach unseren Berechnungen ausgesetzt waren. Die zu Strom umgewandelte Sonnenenergie wurde auch hier mit Kondensatoren und Druckluft, später sollte die Druckluft im Linde-Verfahren verflüssigt werden, gespeichert. Der Antrieb des Luftschiffes war elektrisch.
Die Luftjachten waren modular konzipiert, wir wollten deren Größe den Wünschen der Kunden anpassen, aber die erste Serie – drei Stück – bauten wir uniform: sechzig Meter lang, zwanzig Meter im Durchmesser. Ihr Volumen betrug demnach circa 16.750 Kubikmeter, bei einem Eigengewicht von neun Tonnen konnten die ersten Luftjachten eine Nutzlast von über sieben Tonnen tragen. Ein solches Ausmaß reichte für gut zehn Passagiere, viel Gepäck und jede Menge Luxus und Proviant, den Treibstoff nicht zu vergessen. Wir beantragten die Musterzulassung für Europa am selben Tag der Flugtaufe, für die USA drei Wochen später. Mit dem Segen der europäischen Luftfahrtbehörde und ihres US-amerikanischen Pendants, der FAA (Federal Aviation Administration), würden viele Hürden fallen, aber es war ein langes und teures Prozedere.
„Wieder Schmiergelder! Wie soll ich das verbuchen?“, seufzte Herr Klaasen. Seine Sorgen möchte ich haben. Für derartige Überlegungen bezahle ich ihn doch. Meine geliebte Frau hält lieber dennoch ein Auge auf das ganze Vorgehen; sie meint, wir könnten dafür im Gefängnis landen, sie will sicher gehen, dass es ordentlich gemacht wird. Sie nannte es streng nach Vorschrift verkehrt handeln.
Die Gondel war im Verhältnis zur gesamten Luftjacht sehr groß: dreißig Meter lang und zwanzig Meter breit, vorn und hinten abgerundet, um eine bessere Aussicht zu erhalten. Im unteren Stock (es gab derer zwei) war die Technik untergebracht einschließlich der Pilotenkanzel, die Kojen für die Crew und die Lager für die Lebensmittel. Die Gaskammern (so heißen die Teile nun mal) waren von mehreren Gängen durchzogen, um das Innere des Luftschiffes im Auge behalten zu können und um Zugang zu den Motoren zu haben für den Fall, dass die mal zu warten wären. Auch diese Gänge waren mit Aerogel isoliert, das bot die Gelegenheit zu einem milchigen Blick in das Innenleben der Schiffe. Den Passagieren war der Zutritt zu diesem Bereich natürlich untersagt, die Gänge dienten der Technik, nicht dem Vergnügen. Um dem Schiff einen stabileren Flug zu ermöglichen, damit den Passagieren bei Seegang (oder Luftgang? Also, Turbulenzen!) nicht übel würde, verringerten wir die Schaukelbewegungen des Schiffes mit einer cleveren Anlage: Alle schweren Teile, wie die Linde-Maschine, die Druckluftbehälter, die Kondensatoren und Akkus waren auf einer beweglichen Plattform gelagert. Ein ausgefeiltes System von Sensoren (die billigsten fanden wir bei Spielkonsolen, die konnte man preiswert umprogrammieren und waren millionenfach erprobt) glich die Bewegungen des Schiffes aus, indem es die schwere Technik in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Ich hatte mich für dieses System von erdbebensicheren Gebäuden inspirieren lassen, die Passagiere dankten es mir. Besonders die, die leicht seekrank wurden, wie meine geliebte Frau. Die schwenkbaren Propeller unterstützten die stabilisierende Bewegung. Sven Maven amüsierte sich über die so erzielte Stabilität.
„Das ist ja eine ganz neue Bedeutung des Begriffs der Schiffsschaukelbremse! Ein Job, wie geschaffen für Nicco!“
Nicco Gassi verstand es als Kompliment, obwohl er die Methode nicht selber erdacht hatte. Ich dagegen glaube, dass die Bemerkung als Stichelei gemeint war.
Für die Steuerelektronik bedienten wir uns älterer Computer. Das habe ich mir bei der NASA abgeschaut, die verfährt mit gutem Grund ebenso: Zum einen sind ältere Computer billiger, sie sind nicht so übertaktet wie die letzten Modelle und sie sind erprobter. Die Bugs im System und bei den Anwendungsprogrammen sind bekannt, nur die Rechengeschwindigkeit ist geringer. Alle flugrelevanten Systeme kommen natürlich als Sicherheitsmaßnahme in dreifacher Ausfertigung unabhängig voneinander und räumlich getrennt vor.
Luftschiffe werden von Luftfahrtexperten oft als „Schönwetterflieger“ verspottet oder gar verachtet, uns ging es kein bisschen besser. Es stimmt in der Tat, dass Luftschiffe – und unsere Luftjachten waren da natürlich keine Ausnahme – sehr wetteranfällig sind. Wir machten aus dieser Not eine Tugend: Wir versprachen unseren Gästen immer gutes Wetter. Dieses Versprechen konnten wir nur einhalten, indem wir auf feste Routen und Fahrpläne verzichteten, aber der Preis war es wert. Mit dieser Methode erreichten wir eine sehr hohe Sicherheit und unsere Gäste bekamen immer Sonne. Im Gegenzug wussten sie nie mit Gewissheit, wo sie ein- und aussteigen würden, oft mussten wir kleine Chartermaschinen einsetzen, um sie dorthin zu bringen oder von unserem wetterbedingten Zielort nach Hause zu fliegen. Bei dem, was wir für unsere Flüge kassieren wollten, fiel dieser Posten nicht sonderlich ins Gewicht. Für manche Gäste war diese Ungewissheit Teil des Abenteuers, die anderen mussten sie halt akzeptieren. Sicherheit ging vor und brachte in diesem Falle sogar ein Plus an Bequemlichkeit während des Fluges und etwas Spannung bei der Routenplanung. Hinzu kam, dass wir mit dieser Vorgehensweise die Energieausbeute maximierten. Genug Erfahrung hatten wir mittlerweile mit den Augen gesammelt, die ebenfalls stets die sonnigste Route bevorzugten. Den Vendobionten, weit über den höchsten Wolken, war das Wetter egal.
Um die Sicherheit unserer Luftjachten kontrollieren und garantieren zu können, bildeten wir unsere eigenen Piloten in unserer eigenen Flugschule aus. Wir hatten zunächst nicht geplant, Schiffe an Dritte zu verkaufen (mit Ausnahme der Türken, das hatte sein müssen). Damit wollte ich für uns sicherstellen, die Maßstäbe für die Sicherheitsstandards kontrollieren zu können. Es war klar, dass ein Unfall, vielleicht sogar mit Todesfolge, im schlimmsten Fall vor der Linse einer laufenden Kamera (und jeder scheint heutzutage ständig eine Kamera dabeizuhaben, nicht nur unsere Augen), ein schwerer Schlag für unser Geschäftsmodell gewesen wäre: Noch heute sieht man im Fernsehen in regelmäßigen Abständen Dokumentarfilme mit dem Absturz der brennenden Hindenburg. So etwas durfte sich nicht wiederholen. Zwar stellten wir bald zehn Prozent der verfügbaren Flugstunden, zum Teil umsonst, zum Teil stark ermäßigt, für wissenschaftliche und humanitäre Zwecke zur Verfügung (in erster Linie als PR-Maßnahme, ich legte Wert darauf, unser not-evil-Image auszubauen, um Anschlägen, Boykottaufrufen und anderen Problemen vorzubeugen), aber wir bestimmten die Piloten der zur Verfügung gestellten Flüge stets selber und deren Instruktionen waren strikt. Sicherheit lautete das oberste Gebot. Ohne Ausnahme. Wenn Wissenschaftler den Regenwald von oben studieren wollten, dann nur bei gutem Wetter. Den Opfern eines Erdbebens konnte sofort Hilfe geboten werden, den Opfern eines Orkans nicht, bis dieser sich nicht gelegt hatte. Kein Pilot wagte es je, diesen Anweisungen zuwiderzuhandeln. Da wir an alle Luftjachten Außenkameras installiert hatten, die wir von der Leitzentrale aus beobachten konnten, konnte ich die Einhaltung der Regeln genau kontrollieren.
Leider erwiesen sich die neuen Schiffe zunächst als Flop: Die Leute sahen lieber von zu Hause aus die Welt auf ihren Monitoren und durch ihre Super-Brillen und wollten zunächst nicht nur keine eigene Jacht kaufen, was wir ihnen ohnehin noch nicht gestatten wollten, sie wollten sie zudem nicht einmal chartern. Ich war platt, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Wir würden sowohl die Technik, vor allem jedoch die PR verbessern müssen. Wie kriegt man Menschen dazu, für etwas zu bezahlen, von dem sie nicht wissen, dass sie es brauchen?
„Man muss ihre Neugierde wecken“, sagte meine geliebte Frau.
„Man muss sie neidisch machen“, entgegnete Nicco.
„Es muss billiger sein“, ergänzte Herr Augsburger.
„Kaum jemand hat eine Fliegerlizenz für Luftschiffe. Entweder wir organisieren auch für die privat genutzten Luftjachten die Piloten oder wir bilden unsere heutigen Mieter und späteren Käufer selber aus. Oder, das wäre vielleicht das Beste, wir steuern die Luftjachten von hier aus, wie wir die Augen ja auf gleiche Weise von hier aus fliegen“, schloss ich die Debatte. Die anderen hatten natürlich recht, aber ich hatte mehr recht als sie, deshalb war ich der Boss. Ich wusste nur noch nicht, in welchem Punkt ich recht hatte.
„Dann müssen wir den Passagieren aber garantieren können, dass niemand anderes jemals die Kontrolle über die Luftjachten übernehmen kann“, warf Sven Maven zutreffend ein.
„Das ist heute schon der Fall. Niemand hat je ein Auge entführt.“ Meine geliebte Frau und ich wussten, dass der letzte Satz nicht ganz der Wahrheit entsprach, sagten aber natürlich nichts dazu. Stattdessen sprach wieder Sven Maven:
„Ob ein Auge entführt wird oder nicht, ist nicht vergleichbar. Die Kunden sind nicht persönlich an Bord der Augen, sehr wohl hingegen an Bord der Luftjachten. Das macht einen Unterschied. Man kann aus der Luftjacht nicht einfach so aussteigen, wie man eine Super-Brille von der Nase abnehmen kann.“
Darüber würde ich nachdenken. Ganz unrecht hatte er nicht. Zunächst schwieg ich jedoch; er war nicht der Boss, der war einzig und allein ich. Zusammen mit meiner geliebten Frau, natürlich.
zurück • vor