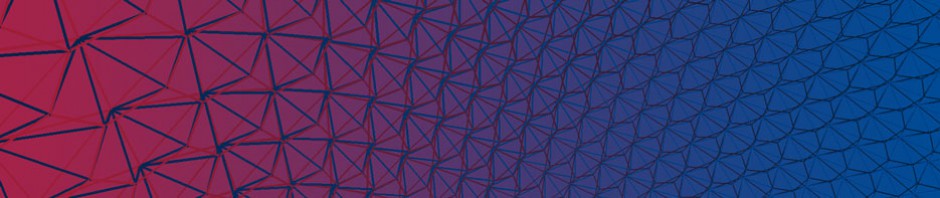Es hat sich im Laufe der Zeit eingependelt, dass meine geliebte Frau und ich abwechselnd schlafen, mit ungleichen, zeitversetzten Rhythmen und gelegentlichen Überschneidungen. Im Prinzip bedeutet das acht Stunden Schlaf für einen, anschließend acht Stunden Schlaf für den anderen, um schließlich die nächsten acht Stunden zu zweit zu verbringen. Diesem Prinzip zufolge würde immer einer Wache halten. In Wirklichkeit schlief ich meistens unter sieben Stunden pro Schicht (außer wenn ich abends getrunken hatte), meine geliebte Frau hingegen neun oder zehn; obendrein blieb ich lange wach, meine Tage waren insgesamt länger als 24 Stunden, womit sich unsere Schlaf- und Wachphasen andauernd gegeneinander verschoben. Manchmal schliefen wir beide. Das betrachteten wir bald als normal und gewöhnten uns daran, obwohl es für unseren psychologischen Frieden besser gewesen wäre, starre Routinen zu haben. Meine geliebte Frau ging eher einem geregelten Tagesablauf nach, ich hingegen versuchte aus der Planlosigkeit eine Routine zu machen. Wir vertrauten dem Autopiloten zunehmend mehr, notgedrungen. Er arbeitete während unseres Schlafes nicht unzuverlässiger, als wenn wir wachten, und wenn wir wachten, mussten wir selten eingreifen. Die Hyperborea ließ sich – mehr oder weniger risikoreich – vorprogrammieren: Wenn wir schlafen wollten, brauchten wir die entsprechenden Parameter nur einzugeben. Wann immer meine geliebte Frau aufwachte, widmete sie sich ihrer Rituale, um die ich sie beneidete. Sie gaben ihr Ruhe. Erst Tee trinken, gleichzeitig mit den Katzen schmusen, vor allem mit dem Kater. Der Kater war „morgens“, d.h. aus seiner Sicht kurz nachdem meine geliebte Frau aufstand, sehr anhänglich, später kam des Öfteren die Mieze, dann wurde gelesen. Im Anschluss daran achtete meine geliebte Frau darauf, dass das Schiff funktionierte, die Rechner liefen, die Verbindungen mit den Augen und den Vendobionten aufrecht erhalten wurden, dass alles sauber und ordentlich blieb. Je nachdem, wie gerade unsere beiden Schlafzyklen zueinander standen, frühstückten wir beide zusammen oder ich aß zu Mittag oder zu Abend mit ihr, während sie frühstückte, oder sie aß halt allein, weil ich gerade schlief. Wenn ich dann wach wurde, versuchte ich, Neues zu besorgen, vor allem Essbares. Zuweilen las ich auch, aber weniger als sie. Ich bin seit der Anfangszeit in der Sahara mit sehr wenigen Ausnahmen der Einzige von uns beiden, der festen Boden betreten hat. Meine geliebte Frau wollte einfach die Hyperborea nicht mehr verlassen und ich hatte ja, wie geschildert, mittlerweile nicht einmal Angst. Foc, der mich – im Gegensatz zu seiner Haltung meiner geliebten Frau gegenüber – immer mehr anhimmelte, wollte natürlich ständig raus. Wenn er an Bord war, hielt er zu gern die Schnauze in den Wind: Zu diesem Zweck hatte ich ihm ein Extrazimmer eingerichtet, mit einer Katzentür, groß genug, um ihn bequem hereinzulassen, aber so schwer zu bedienen, dass die Katzen sie nicht ohne Hilfe aufschubsen können. Manchmal schafften sie es doch, vermutlich schlüpfen sie mit ihm hinein, wenn er den Raum betritt. Wenn das wieder passierte, jammerten sie, wenn sie nicht herauskamen, bis wir sie erlösten und die Tür öffneten. In diesem kleinen Seitenraum im oberen Stock der Hyperborea stand das Fenster von einem nach außen gewölbten Insektengitter abgesehen, zu jeder Zeit offen, Foc hing gern seine Schnauze hinaus, die Vorderpfoten an den Fenstersims gelehnt. Stundenlang. Immer wieder winselte er und bettelte darum, hinausgehen zu dürfen. Früher oder später, mindestens einmal am Tag, gab ich nach, natürlich. Meine geliebte Frau schaute bei diesen Spaziergängen von oben herab zu und bewachte die Umgebung mittels der Augen in der Nähe. Ich hatte ihr versprochen, nie herunter und aus dem Schiff zu gehen, wenn sie schlief, und das Versprechen hielt ich ein. Es war eine vernünftige Maßnahme. Ich hatte keine Angst, aber ich war auch nicht blöd! (Wird meine geliebte Frau zu meinem Über-Ich? Ja, warum nicht? Das Recht steht ihr zu.) Infolge dessen verbrachten wir weniger Zeit zusammen. Der größte Nachteil unseres azyklischen Schlafmusters war die nachlassende Libido. Dafür war ich häufig mit meinem Hund zusammen. Manchmal dachte ich, er brauchte mich mehr als meine geliebte Frau. Meine geliebte Frau und ich haben gemeinsame Erinnerungen, wir können lesen, Filme und alte Aufzeichnungen ansehen. Der Hund erkannte mittlerweile ausschließlich mich als Bezugswesen an und himmelte mich sabbernd an. Die Katzen kamen allein viel besser klar.
Als Ersatz für die Libido kochte ich oft. Wir aßen dann zusammen, wenn wir beide gleichzeitig wach waren, und für den Fall, dass sie schlief, ließ ich meiner geliebten Frau das Essen fertig zubereitet in der Kombüse stehen, sie brauchte es nur aufzuwärmen. Ich fror vieles ein, auch Halbgekochtes, das lässt sich sehr gut und mit wenig Mühe fertig zubereiten. Ich nahm langsam wieder zu, wenn ich so weitermache, dachte ich bei mir, werde ich bald dicker sein als vor meiner Grippe.
Manchmal diktierte ich meine Aufzeichnungen und Erinnerungen in meinen Diktiertranskriber. Ich redete mit diesem Gerät oder, genauer gesagt, mit dieser Funktion meines iTempt™, das mir immer mehr wie ein elektronischer Schnuller vorkam, mehr als mit meiner geliebten Frau. Der Diktiertranskriber verstand mich zunehmend besser, er verfügt über eine lernfähige Korrekturfunktion. Meistens war ich aber selbst zum Reden zu faul, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Da auf dem Schiff allerdings immer weniger Erwähnenswertes passierte und ich immer mehr Erinnertes aus der Vergangenheit diktierte, würden diese Aufzeichnungen irgendwann ziemlich vollständig sein. Dafür etwas unordentlich, fürchte ich. Welcher Mensch wäre wohl in der Lage, sie zu verstehen, wo doch keine Menschen mehr da sind?
Ist ja nur eine rhetorische Frage…
Zurück zu meiner geliebten Frau: Wenn ich darüber nachdenke, ist sie letztendlich in der Tat zu meinem Über-Ich geworden; ich muss mich daran gewöhnen, dass ich sie brauche, um zu überleben und um aus dem Übermut heraus, der sich leicht aus der Angstlosigkeit ergibt, keine Dummheiten zu machen. Auf diese Art wurde mein Lebenswille zu einem intellektuellen Diktat. Ich musste überleben; nicht, weil ich einen Überlebenswillen hatte, sondern aus Überzeugung, aus rationaler Überlegung, weil ich dazu da war, weiterzuleben. Ich merkte, dass mich meine geliebte Frau beobachtete. Ich überlebte auch für sie, ich blieb folgsam. Das war ich ihr schuldig. Es war nicht zu meinem Schaden. Es war eine stabile Situation, damit konnte ich leben. Sie, die Situation, folgte einer mir einleuchtenden logischen Ästhetik.
zurück • vor