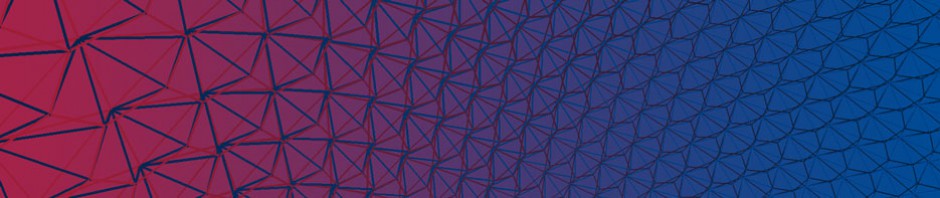So will ich ihnen vom Verächtlichsten sprechen, das aber ist der letzte Mensch. […] Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten. […]
Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme. Krankwerden und Misstrauen-haben gelten als sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert! Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben. […]
Man ist klug und weiss Alles, was geschehen ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald. Sonst verdirbt es den Magen.i
Friedrich Nietzsche
Also sprach Zarathustra
In Südfrankreich trafen wir im Sommer 2031 auf eine Krötenplage biblischen Ausmaßes. Die Felder wimmelten nur so vor Amphibien, selbst tagsüber und in der prallen Sonne sah man sie von oben watscheln und sie fraßen alles, was kleiner war als sie und sich bewegte. Es gab keine Schnecken, kaum Insekten und die kleinen Kröten hatten es auch nicht leicht, denn sie fielen den großen oft zum Opfer. Die Teiche waren schwarz vor Krötenlaich und Kaulquappen. Wir sahen keine anderen Raubtiere: Füchse, Katzen, Hunde, Schlangen…– sie alle schienen die Kröten angegriffen zu haben, was ihnen offenbar nicht gut bekommen war. Die Kröten waren giftig. Jede Kröte konnte einen Räuber töten, wobei sie meist selber draufging, aber dafür wiederum konnte sie Abertausende Eier laichen. Wir hatten endlich einen Platz gefunden, an dem die Insekten und die anderen Schädlinge das Obst und das Gemüse nicht kahl fraßen, bevor es reifen konnte. Der Hund und die Katzen mussten natürlich an Bord der Hyperborea bleiben. Die Katzen waren es gewohnt, aber Foc wurde mürrisch. Nach einigen Tagen musste ich ihn doch herauslassen, schon allein deshalb, weil er sich nicht angewöhnen sollte, an Bord Gassi zu gehen; daher musste ich ihm einen Maulkorb basteln. Den mochte er nicht besonders, aber nach einiger Zeit gewöhnte er sich an ihn. Wir füllten unsere Vorratskammer mit Äpfeln, Karotten, Kohl, den wir zu Sauerkraut verarbeiteten, Aprikosen, Pflaumen, Artischocken, Kartoffeln, Auberginen, Zwiebeln, Knoblauch… Vieles mussten wir einlegen, um es haltbar zu machen, anderes froren wir ein. Die Kartoffeln einzusammeln, war am mühsamsten gewesen, wir konnten sie nicht einfach pflücken wie die meisten anderen Lebensmittel, sondern mussten sie ausgraben. Sieben große Säcke haben wir mit ihnen gefüllt, bis wir Blasen an den Händen hatten. Jetzt liegen die Kartoffeln in den Lagerraum bei 5 °C im Dunkeln. Hoffen wir, dass sie eine Weile halten. Ziemlich klein sind sie, die Bauern hier waren offenbar schlau oder die Kartoffeln degenerieren ohne menschliche Aufzucht.
Endlich Äpfel ohne Wurmstich. Die meisten jedenfalls. Äpfel kann man ebenfalls gut lagern, im selben Kühlraum breiteten wir in den Regalen unsere Ernte auf Papierbögen aus. Allerdings sind die Äpfel kleiner als früher, ich nehme an, das liegt daran, dass niemand die überzähligen Früchte ausdünnt; die Bäume tragen zu viel Frucht und die Sonne scheint durch die schwebende Asche nicht so stark wie noch im letzten Jahr. Dafür sind sie jetzt schmackhafter, aber das könnte an unserer verklärten Erinnerung liegen. Oder die Asche ist ein guter Dünger. Die kleinen Äpfel laufen, so kannte ich es aus meiner Kindheit, an den Schnittstellen schnell braun an, das hatte ich länger nicht mehr beobachtet. Und sie verströmen ein wunderbares Aroma aus, ein Apfel aromatisiert einen ganzen Raum.
Die Zwiebeln und der Knoblauch waren leicht zu finden und zu ernten: Wir zogen einfach an den Blättern, die schon angebräunt waren, und die Früchte kamen hinterher, dann banden wir sie an den trockenen Blättern zusammen. Zwiebeln und Knoblauch wuchsen durcheinander, einige Blütenstände waren bereits vertrocknet. Ich hob sie auf in der Hoffnung, aus ihnen Samen für meine geliebte Frau zu gewinnen. Insgesamt ernten wir drei Säcke Zwiebeln und einen Eimer Knoblauch, das muss über ein Jahr reichen, wenn wir mehr brauchen, kommen wir wieder. Länger als ein Jahr halten Zwiebeln ohnehin nicht, ich werde herumexperimentieren, ob man sie einfrieren kann. Einen Teil legen wir in Öl ein, mit Kräutern, das sollte auch eine Weile haltbar sein.
Am meisten freute ich mich über die Artischocken. Die Pflanze ist mit der Distel verwandt und hat die Verwilderung offenbar sehr gut überstanden. Kein Mangel an Hybridisierung, kein Zwergwuchs und keine Fraßspuren. Die Kröten haben die Schnecken, die sonst Artischockenpflanzen gern befallen, ausgemerzt. Darüber hinaus sind Artischocken sehr genügsame Pflanzen, die wenig Pflege brauchen. Ihre Ernte ging leicht von der Hand: mit einem langen Küchenmesser alle Knospen, die noch nicht verblüht waren, abschneiden – mit Schwung, zack! – und in einem Korb sammeln. In der Küche der Hyperborea die zähen äußeren Blätter abzupfen, die Knospen vierteln, das Stroh herausschneiden und wegwerfen, die geviertelten Knospen kurz blanchieren und sofort einfrieren. Die eingefrorenen Stücke dann einzeln mit kaltem Wasser besprühen, damit sich eine schützende Schicht Eis um sie herum bildet, so vermeidet man Frostbrand. Anschliessend kamen sie in den -25 °C kalten Lagerraum, zusammen mit dem Fleisch und dem Fisch. Keine schwere Arbeit, aber man bekommt dunkelbraune bis schwarze Finger von ihr, besonders unter den Fingernägeln. Wenigstens stinkt man nicht im Gegensatz zum Einlegen der Zwiebeln und des Knoblauchs und die Verfärbung der Finger lässt sich mit Zitronensaft reinigen. Als nächstes müssen wir also noch Zitronen finden. Orangen müsste es gleichermaßen irgendwo geben.
Tomaten, Bohnen und Erbsen fanden sich ebenfalls. Die Tomaten hängten wir zum Trocknen rispenweise im Laderaum auf. Das war sehr einfach und roch gut. Später kochte ich große Mengen Soße daraus ein, die kann man gut einfrieren, auch wenn sie beim Auftauen leicht fad schmeckt und nachgesalzen und nachgewürzt werden muss. Die Bohnen und die Erbsen machten mehr Arbeit: Den Bohnen mussten die Fäden gezogen werden, bevor man sie einfrieren konnte, die Erbsen mussten wir aus der Schote pulen. Die Auberginen haben wir in Scheiben getrocknet.
Mit dem Einlagern und Konservieren der gesammelten Lebensmittel waren wir mehrere Wochen in dieser Krötengegend beschäftigt. Mir tat der Rücken weh. Meine geliebte Frau, die sich weiterhin weigert, die Hyperborea zu verlassen, meinte dazu:
„Die beste Erfindung aller Zeiten war offenkundig der Traktor. Vor einem Jahr reichten zwei Prozent der Menschen, um alle anderen mit Lebensmittel zu versorgen. Und sie haben nicht so gejammert wie du.“
Ich konnte ihr nur recht geben.
Mehl, Getreide und Zucker blieben ein Problem. Getreide schien nirgendwo zu wachsen. Meine geliebte Frau meinte, das liege an den Terminatorsamen, die die großen Landwirtschaftsunternehmen weltweit flächendeckend vertrieben. Diese Samen waren genetisch so manipuliert worden, dass sie zwar keimten, aber keine gangbaren Körner erzeugten. Die neue Ausaat musste man eigens bei diesen Unternehmen kaufen. Sie hatten ein Monopol darauf. Früher benutzten die Bauern einen Teil der Ernte als neue Aussaat, das war den Saatunternehmen zu primitiv; sie überzeugten viele Regierungen, dass man auf diese Weise keine gute Planung der Lebensmittelproduktion garantieren könne, woraufhin die entsprechenden Gesetze erlassen wurden. Aus Sicht der Unternehmen war die traditionelle Methode ohnehin nicht lukrativ genug. Das Getreide auf den sich selbst überlassenen Feldern war verfault, aus den Ähren keine neuen Pflanzen gewachsen. Die Pflanzenschutzmittel, die noch im Boden ihre pflanzentötende Wirkung entfalteten, machten eine Rekolonisierung der ehemaligen Anbauflächen für wilde Pflanzen schwer. Deshalb gab es nun weitläufige Gebiete, in denen kaum etwas wuchs. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen war staubig im Sommer und schlammig im Winter. An anderen Stellen wuchsen Farne, Schachtelhalme, Gräser und Moose, alles Vertreter der sogenannten Pioniervegetation, die typisch für schwer gestörte Ökosysteme ist.ii Sie besiedelt als erste offene Landschaften und kann selbst unter schwierigen Umweltbedingungen auf sauren Böden und mit wenig Licht überleben, dafür bildet sie wenig Nahrhaftes für Pflanzenfresser. Na ja, ich weiß sowieso nicht, wie wir – ohne Maschinen – Getreide hätten ernten können, wenn es denn welches gegeben hätte. Mühselig vermutlich und nur in kleinen Mengen. Viele Silos waren geborsten, nach einigen weiteren Jahren ohne Wartung würden vermutlich auch die noch intakten Anlagen dem Gewicht ihres Inhaltes nicht standhalten können. An etlichen sah man Brandspuren, diese Silos hatten wohl die Menschen selber zerstört oder sie waren vom Blitz getroffen worden.
Menschenleichen gab es auch immer wieder zu entdecken. Am besten erhalten waren die Leichen im Inneren von PKWs, vor allem dann, wenn die Windschutzscheiben noch intakt waren. Merkwürdig, wie viele Menschen den Tod in ihren Autos gefunden hatten. Der Innenraum ist in dem Falle oft von feinsten Schimmelfäden durchzogen. Wie eine Raupe im Kokon befindet sich darin die jeweilige Leiche, in der Regel eingetrocknet, mit eingefallenen Wangen und ausgehöhlten Augen – wie eine Mumie – oder verfault. Warum manche Leichen mumifizierten, andere hingegen verfaulten, ist mir rätselhaft.
Hier und da entdeckten wir Vorräte in Häusern, Hallen, Lagern oder Läden. Das meiste war verrottet, verbrannt oder durch Wasser unbrauchbar geworden, schimmelig oder madig. Gelegentlich hatten wir Glück und es fanden sich Nudeln, Zucker oder Mehl in trockenen, dunklen Vorratskammern. Auch Gewürze waren in vielen Küchen vorhanden, darüber freute ich mich jedes Mal, selbst wenn die Aromen sich mit der Zeit verflüchtigt hatten. Diese Art des Sammelns nahm jedoch viel Zeit in Anspruch. Obwohl wir seit über fünf Monaten keine Menschenseele gesehen hatten, bestand meine geliebte Frau darauf, dass wir jedes Haus, das wir zu betreten planten, vorher einen Tag und eine Nacht lang von den Augen aus ausspionierten, um uns nicht in Gefahr zu begeben. Erst dann, wenn sich nichts gerührt hatte, durfte ich mich mit dem großen Schiff nähern. Ich befolgte den Rat meiner geliebten Frau und empfand im Nachhinein oft das Gefühl, mich wegen einer zu kleinen Beute zu sehr angestrengt zu haben. Manchmal fanden wir Bücher, aber die, die wir hätten haben wollen, hatten wir bereits auf Festplatte oder auf dem Holospeicher von unserem Computer Deep Doubt an Bord gespeichert. Mal entdeckten wir Waffen, aber davon hatten wir eigentlich genug. Munition war willkommen, doch gerade hier in Frankreich fand sich mehr Schrotmunition als richtige Gewehrkugeln, die uns gelegener gekommen wären. Wir werden irgendwann in die ehemaligen USA fliegen müssen, ich nehme an, dort finden wir viele für unsere Zwecke geeignetere Waffen. Oder wir stöberten Werkzeuge auf, die jedoch im Allgemeinen nicht so präzise wie meine waren. Dosen mit konservierten Lebensmitteln brachte ich viele zutage, aber ich war mir nicht sicher, ob sie bedenkenlos konsumiert werden könnten – wegen der Botulismusgefahr. Ich nahm dennoch stets einige von ihnen mit, sofern das Verfallsdatum nicht überschritten war. Ich sehnte mich nach einem kühlen Bier, aber das gab es fast nie, und schon gar nicht gekühlt. Am meisten, ich bleibe dabei, freute ich mich immer wieder – wenngleich immer seltener – über Mehl, Nudeln und Zucker. Honig, Tee, Kaffee, Wein und Schaumwein, Whisky und andere Spirituosen, Speiseöle und Essig, Klopapier und normales Papier, um nur einiges zu nennen, was mir spontan durch den Kopf geht, waren in Ordnung und wir legten von diesen und natürlich von anderen Sachen Vorräte an, die allerdings nicht ewig hielten. Den Großteil dessen, was wir brauchten, stellten wir entweder selber her oder wir besorgten es uns aus der Natur. Oder aber – und das war immer öfter der Fall – wir verzichteten kurzerhand notgedrungen darauf.
„Wir verkommen zu Jägern und Sammlern“, klagte Klaus Klaasen.
„Wir sind zu Parasiten einer toten Zivilisation geworden, Nekroparasiten sollten wir uns nennen“, entgegnete ich. Uns erreichen heute die Güter und zuweilen sogar Gedanken der Verstorbenen, wenn wir uns Mühe geben, diese wahrzunehmen, wie uns das Licht ferner Sterne, die jetzt, wo es uns des Nachts auf der Oberfläche diesen für uns Menschen einsam gewordenen Planeten erreicht, am Ende ihres Zyklus, ihr Treibstoff verbraucht, schon längst als Supernovae explodiert sein können oder einfach nur – erloschen.
„Also, Aasfresser“, ergänzte charmant Beata Nalga Maloumie.
„Früher waren wir Zukunftsfresser, die noch nicht erbrachte Leistungen vorzeitig konsumierten. Heute ernähren wir uns von den Resten der Vergangenheit.“ ergänzte Sven den hoffnungsfrohen Gedankengang.
„Die Arbeitsteilung ist mit einer Handvoll Menschen nicht mehr gangbar, wir agieren wie Universalgenies“, setzte meine geliebte Frau die aufbauende Unterhaltung fort. Sie entwickelte sich langsam zur Bäuerin, sie wusste zunehmend mehr über Pflanzen. Sie nahm für ihre Pflanzen nach und nach mehr Zimmer in Beschlag. Ihre Lampen verbrauchen viel Strom, aber den haben wir im Überfluss. Ich fand ihren Ansatz gut – sie sicherte die Grundernährung und erweitert langfristig unsere Nahrungsvielfalt. Sie verließ als einzige von uns die Hyperborea schon lange nicht mehr.
Meine geliebte Frau sät Salat, Tomaten, Karotten, Gurken, Kohlrabi, Zucchini, Auberginen, Erbsen, Bohnen usw. aus in mehreren eigens zu diesem Zweck hergerichteten Zimmern (wir haben ja genug!) mit künstlicher Beleuchtung. Klaus, Sven und ich helfen beim Bauen eines Be- und vor allem eines Entwässerungssystems, das wir mit dunkler Erde, die uns fruchtbar erscheint, bedecken. Wir holen die Erde, schwarz und wasserspeichernd, aus der Ukraine aus verschiedenen Wäldern, mit Nadeln und Blättern; rote Erde aus Katalonien, lehmig; staubige Erde aus dem mittleren Westen der ehemaligen USA, so fruchtbar, so überdüngt, auch aus der argentinischen Pampa: von überall ein bisschen, immer wieder neue Erde. Später experimentierte sie mit hydroponischen Kulturen, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Wir hatten uns vorgenommen, eines Tages nach Spitzbergen zur Samenbank zu fliegen, die man offiziell „Svalbard globaler Saatgut-Tresor auf der norwegischen Insel Spitzbergen, Teil der Svalbard-Insel-Gruppe“ nannte – ein Name, der uns lustig erschien und über den wir witzelten. Mal sehen, was wir finden, wenn wir tatsächlich jemals dorthin fliegen. Einer der vielen Pläne, die wir hatten.
„Naja, Genies stelle ich mir anders vor…“, schloss ich die Debatte. Für unsere Verhältnisse war das schon sehr eloquent gewesen. Wir waren bereits seit über einem Jahr zusammen unterwegs, wir agierten phasenweise automatisch, wir redeten selten in Gruppen von mehr als drei Personen. Ich dachte für mich, dass das nicht die Crew gewesen wäre, die ich mir unter anderen Umständen selbst ausgesucht hätte. Die Letzten Menschen sind ein Jammer. Aber wenn man die Umstände nicht ändern kann, soll man über einen Jammer nicht larmoyant jammern, sondern die Lage mit Fassung ertragen. Anderenfalls wird es peinlich. Das möchte ich nicht, die Lage ist auch so schlimm genug.
Die Letzten Menschen sind wir in der Tat geworden, das ist nicht schmeichelhaft. Ich beobachte, was Beata Maloumie mit den Augen verfolgt, meine geliebte Frau versichert mir, dass Beata nichts davon erfährt. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Falltür in unserem System mittlerweile versperrt ist, niemand kann uns ausspionieren. Umgekehrt ist das sehr wohl möglich: Beata besucht virtuell die letzten Berggorillas – aus der Ferne, ohne sie zu stören. Die Gorillas leben selbstverständlich weiterhin im ehemaligen Virunga-Park: Sie haben sich in Gruppen zusammengetan, die mangels der ermordeten Weibchen ausschließlich aus erwachsenen Männchen bestehen. Immer noch herrscht ein Silberrücken über die Gruppe, sie ernähren sich nach wie vor vegetarisch, bauen jede Nacht ein neues Nest, um zu schlafen, und toben ihre überschüssige Aggressivität durch Rangkämpfe aus. Diese Rangkämpfe deprimieren mich, denn ich sehe in ihnen keine Funktion mehr. Es ist viel Show dabei, wie bei Gorillas üblich – viel Gebrüll und Brusttrommeln, sie werfen sich Stöcke zu, treffen aber nie. Ich glaube, sie wollen ihr Ziel gar nicht treffen, womit es streng genommen kein Ziel im eigentlichen Sinne ist. Gut mit den Händen zielen, können nur Menschen, manche Kobras und Schützenfische können sehr gezielt spucken, aber nur der Mensch scheint die Abstraktionsfähigkeit zu haben, um mit Steinen weit zu zielen. Dieser Mangel an Abstraktionsfähigkeit ist der Grund, weshalb sogar intelligentere Tiere wie Foc und unsere Katzen, wenn man mit ausgestrecktem Finger auf etwas zeigt, nicht auf den gezeigten Gegenstand, sondern auf den Finger schauen. Und selbst ein aggressives Schimpansen-Männchen im Furuvik Zoo in Gävle, etwa hundertundfünfzig Kilometer nördlich von Stockholm, das sich dadurch auszeichnete, in ruhigen Stunden Steine, Betonbrocken und andere Wurfgeschosse zu sammeln, um damit während der Besucherzeiten Menschen zu bewerfen, traf im Laufe der über zehn Jahre, in denen dieses Verhalten studiert wurde, sehr selten und eher zufällig seine Ziele. Santiago, so wurde der Schimpanse von den Menschen gerufen, machte vor allem Kindern Angst, daher wurde er kastriert.iii Er galt als Beleg dafür, dass manche Affen im Voraus planen können, und das war nun also der Preis für seine Sonderbegabung, sein vorausschauendes Sammeln von Wurfgeschossen. Planen konnte er scheinbar, zielen hingegen nicht. Die Gedanken der Menschen, die ihn gefangen hielten, konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Die überlebenden Berggorillas liefen keine Gefahr mehr, von Menschen kastriert zu werden, diese waren sie los. Trotzdem haben ihre Sexualorgane mangels Weibchen keine reproduktive Funktion mehr, dafür war ganz ohne Kastration gesorgt worden. Die Berggorillas onanieren heute oft in der Gruppe, mit links, weil sie dazu neigen, Linkshänder zu sein; aber ich beobachte keine homosexuellen Handlungen. Die Tiere bleiben einsam. Mir kommen sie träge und antriebsarm vor, ohne es mit dem status quo ante vergleichen zu können.
Ich spreche Beata Maloumie nicht auf die armen Tiere an. Ich vermute, sie ist voller Groll. Meine geliebte Frau und ich reden kaum noch mit ihr, überhaupt reden wir alle wenig, ich bemerke jedoch, dass Beata des Öfteren mit Nicco und gelegentlich mit Sven Maven zusammensitzt. Meistens schweigen sie dabei. Wir schweigen auch, wie gesagt. Wir schweigen alle, voneinander getrennt.
zurück • vor