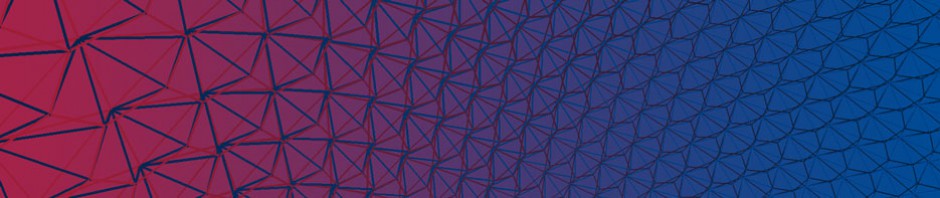Acquérir chaque jour des ignorances solidement fondées.i
Jean Rostard
Pensées d’un biologiste
Seit wir allein sind, kümmert sich meine geliebte Frau um unsere Gesundheit. Keine Arbeitsteilung mehr bedeutet nicht nur, dass Wissenschaft als Paradebeispiel der wettbewerbsorientierten Zusammenarbeit unmöglich ist, sondern auch, keinen Arzt mehr zu haben; man muss sich pflegen. Parasiten sind ein Problem, Krankheiten kann man auskurieren, Parasiten machen meiner geliebten Frau Sorge. Sie redet über Toxoplasmen und streichelt mit gedankenverlorenen Augen den Kater: Dieses Thema habe ich bereits gehört, sie wiederholt es gern, ich höre trotzdem zu. Meine geliebte Frau erzählt mir von den vielen Parasiten, die wir ständig haben, wie sie außer Kontrolle geraten können, wenn unser Immunsystem nachlässt, was jetzt gerade der Fall sein kann; wie sie ihre Wirte manipulieren, kontrollieren. Parasiten wird man selten wieder los. Parasiten sind aber paradoxerweise Symptom eines gesunden Ökosystems, doziert sie. Nicht zum ersten Mal. Wir wollen dann lieber am Rande der Ökosysteme bleiben, meine ich. Ich ließ mich in meiner Angstlosigkeit vom Gesundheitswahn nicht verrückt machen. Sport kommt für mich natürlich genauso wenig in Betracht. Meine körperliche Tätigkeit beschränkt sich auf die täglichen Spaziergänge mit Foc, das muss reichen. Gutes Essen kommt hingegen durchaus in Frage. Ich nehme mir vor, keine rohen Sachen mehr zu essen mit Ausnahme dessen, was meine geliebte Frau an Bord anpflanzt, und der Früchte, die wir einsammeln. Oder wenn ich etwas roh essen will, muss ich es vorher im Raum bei minus fünfundzwanzig Grad tiefgefrieren, eine derart niedrige Temperatur tötet Parasiten auch ab. Fisch für Sushi zum Beispiel behandele ich immer so.
Wir haben schon lange vorgehabt, nach Spitzbergen zu fliegen, zur Arche Noah der Pflanzensamen, jetzt wollte ich mir endlich die Zeit dafür nehmen. Ich sprach meine geliebte Frau an:
„Hast du eine Minute Zeit für mich?“
„Natürlich. Für wen denn sonst?“
„Woran denkst du gerade?“
„An Solipsismus.“ Ich musste lachen, den Sinn für Humor hat sich meine geliebte Frau erhalten. Das ist sicher ein gutes Zeichen.
„Erinnerst du dich an den Svalbard globalen Saatgut-Tresor auf der norwegischen Insel Spitzbergen, Teil der Svalbard-Insel-Gruppe, den wir schon lange besuchen wollten? Ich meine, der Augenblick wäre jetzt günstig. Es ist gerade Sommer im Norden, wenn wir Samen holen wollen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.“
„Stimmt.“ Also machten wir uns auf den Weg zum nördlichen Polarkreis.
Der Anflug war schwer: Als wir endlich in die Nähe Spitzbergens kamen, war das Wetter schlecht, was unseren Aufzeichnungen zufolge hier die Regel war, der Himmel bedeckt, die Winde stark. Nur die Tiefdruckgebiete über Island und dem Kap der Guten Hoffnung konnten mit denen Spitzbergens in Ausdauer und Heftigkeit konkurrieren. Die Inselgruppe ist größer, als ich sie mir vorgestellt habe. Die höchste Stelle ragt über 1.700 Meter über das Meer, so hoch fliegen wir nie. Wir übersteigen seit den Erlebnissen in der Sahara außer in Notfällen, die wir dank der Daten der Vendobionten im Voraus vermeiden können, nie die 500 Meter über N.N. – ein solches Manöver würde jedes Mal unsere Heliumreserven, die immer knapper werden, unnötigerweise schrumpfen lassen. Die Welt unter 500 Meter umfasst über 90 Prozent der Erdoberfläche, den zumeist interessanteren Teil, das reicht uns. Wir umkreisen die Inseln und fischen mit den Augen, die uns begleiten, aus dem Meer. An den felsigen Küsten liegen hier und da verschiedene Arten von Robben und Walrossen, im Landesinneren sehen wir keine Tiere, obwohl uns unsere Aufzeichnungen warnen, dass hier mit Eisbären zu rechnen ist. Früher, als es noch eine Autorität gab, war es verboten, unbewaffnet die wenigen Siedlungen zu verlassen, und selbst mit Waffe musste man eine Genehmigung beim Sysselmann, dem offiziellen Stellvertreter der norwegischen Regierung, beantragen. Des Weiteren sollte es hier eine kleinere Rentier-Art geben, Polarfüchse und Vögel. Vögel sehen wir überall, sonst rührt sich nichts.
Wir sehen durch die Vendobionten die Chance auf eine Wetterbesserung in ein oder zwei Tagen voraus, wenn das Hochdruckgebiet hinter der aktuellen Wetterlage das Geschehen beruhigt. Wärme kann man in Spitzbergen selbst im August nicht erwarten, uns reicht zum Landen Windstille, die gibt es hier selten genug. Vorerst umfliegen wir die Inselgruppe zwischen den Böen und bewundern die zerklüftete Küste und das stürmische Meer aus einer sicheren Entfernung. Die Inselgruppe ist groß und aus sieht aus der Entfernung rau aus, die wenigen Bebauungen sind niedrig und windschief, die Fenster zerschlagen – zerstörte arktische Funktionalität. Am zweiten Nachmittag, der Wind blies nur noch mit vier Knoten, wie Sven gesagt hätte, steuerten wir den Eingang der Samenbank an. Der Eingang war aus der Luft weiträumig zu sehen, 130 Meter über dem Meeresspiegel in einer idealen Höhe für die Hyperborea, eine spitze Dreieckskonstruktion aus Beton, in der sich die Eingangsröhre aus verstärktem Stahl befinden sollte. In dieser harschen Landschaft mit den hohen Bergen sah die Konstruktion relativ klein aus, aber sie war groß genug, um eine Bedrohung für die Struktur der Hyperborea im Kollisionsfalle darzustellen. Meine geliebte Frau landete das Luftschiff in fast einem Kilometer Entfernung in einer flachen, relativ windgeschützten Mulde. Ich nahm das Fahrrad, meinen Rucksack, eine Sackkarre, Foc und wegen der Eisbären eine geladene Pistole mit und machte mich auf den Weg.
Ich habe in den beinahe zwei Tagen, während derer wir die Inseln umflogen haben, nicht nur die Umgebung des Samenbank-Eingangs mittels der Augen untersucht und den Weg studiert, wie meine geliebte Frau es gernhat, sondern zusätzlich dieses und jenes aus Deep Doubts Datenschatz über Spitzbergen studiert. Vermutlich ist das der Grund, weshalb ich überhaupt den fossilen Trilobiten am Wegesrand bemerke, dort, wo der Weg eine kleine Erhebung durchschnitt, um diese abzukürzen. Das Gestein um mich herum stammt aus dem Ordovizium, sehr nahe am Anfang der heute (und nicht nur bis vor kurzem, wie Beata befürchtete) unsere Welt prägenden kambrischen Explosion, aber viele Millionen Jahre nach den Vendobionten, nach denen ich die Vendobionten benannt hatte. Die Welt war damals ganz anders als heute oder als vor wenigen Jahren. Das besagte Fossil war groß wie eine Walnusshälfte, nicht besonders gut erhalten, eine Seite abgesplittert. Es war dunkel wie der Meteorit, den ich damals in der Sahara gefunden hatte, roch jedoch nicht verbrannt, sondern irgendwie feucht. Aber es hatte Augen, Facettenaugen. Die einzigen bekannten Augen eines Lebewesens, die eine mineralische Linse aus Kalziumkarbonat entwickelten, einem Kristall, statt wie die Insekten aus Chitin. Manche dieser Kristalle sind funktionsfähig geblieben und man konnte durch die fossilen Augen hindurch sehen: Kalziumkarbonat ist ein sehr haltbares Material. Daher weiß man (weiß ich!), wie die Augen der Trilobiten damals funktionierten. Das heißt: Man wusste es, weil man es ausprobiert und studiert hatte; ich wusste es, weil ich es gelesen habe.ii Die Augen in meiner Hand waren blind, besaßen aber bei näherer Betrachtung dieselbe Form und Anordnung wie die Zellen, aus denen die Hyperborea bestand – wie ein gewölbter Bienenstock. Der Panzer bestand aus Segmenten, die ineinander übergriffen, ähnlich der Einfassungen, mittels derer der Kontaktkleber die Einzelteile der Hyperborea zusammenhielt.iii Ich hätte das Fossil gern Klaus gezeigt. Eine gedankliche Brücke, die von den Urkrebsen bis zu unserer Hyperborea über 540 Millionen Jahre überspannt. Ich steckte den Stein in meine Jackentasche und radelte weiter. Ich fragte mich, wo ich den Sahara-Meteoriten wohl verstaut haben könnte, ich würde gern beide unwahrscheinlichen Funde zusammen aufbewahren.
Der Eingang zur Samenbank in seiner bestehenden Form wurde entworfen, um einem direkten Flugzeugabsturz oder einer in nicht allzu großer Nähe explodierenden Atombombe zu widerstehen. Zum Glück waren die großen Stahltüren nicht verschlossen, sonst wäre die Expedition hier beendet gewesen. Hinter dem Tor verschwand nach wenigen Metern ein röhrenförmiger Schacht in der Tiefe. Ich schaltete meine Taschenlampe an, stellte das Fahrrad am Eingang ab, ohne es abzuschließen, und betrat die Anlage. Nach weniger als der Hälfte der Strecke (Deep Doubt hatte mir verraten, dass der Gang 120 Meter lang ist) riss der iTempt™-Empfang erwartungsgemäß ab. Jetzt war ich richtig auf mich selbst gestellt. Ich dachte an Buzz Aldrin, die Mondrückseite im engen Orbit umkreisend, während seine Kameraden am Boden das Meer der Ruhe untersuchen. Foc begleitete mich, das war ein Unterschied. Meine Schritte hallten, Focs Trippelgeräusche bildeten eine akustische Untermalung wie ein Jazzschlagzeug, die Taschenlampe warf ihren diffusen Lichtkegel in die Tiefe, der Gang wies eine leichte Neigung auf, aber es tropfte nirgends. Auch solche Toneffekte hätten bei mir keinerlei Angst ausgelöst, dagegen war ich immun. Strom gab es in dieser Anlage lange nicht mehr, so weit im Norden hätte Sonnenenergie die Hälfte des Jahres keinen Sinn gemacht, die Windenergieanlagen haben ohne Wartung dem starken Wind in dieser Gegend nicht standgehalten, der Diesel für die Notstromaggregate ist längst verbraucht. Foc blieb dicht an meinem Bein, verhielt sich aber ruhig, hechelte wie gewohnt. Nach zwei Minuten erreichten wir das Ende des Gangs, ich ließ den Eingang zum Bürobereich auf der rechten Seite liegen, vor mir befanden sich zwei Gänge, die in entgegengesetzte Richtungen führten, mit Türen und Luftschleusen. Sie standen alle offen. Dahinter auf beiden Seiten in jeweils mehreren unübersichtlichen Reihen von Regalen und noch mehr Regalen, scheinbar ohne Ende, soweit die Taschenlampe ausleuchtete, befanden sich Glasbehälter, wie große Einmachgläser, jeder ungefähr halbvoll mit Samen. Auf jedem Glas klebte ein Etikett, handgeschrieben und mit einem Punktecode versehen. Es müssen Millionen gewesen sein (die Gläser, meine ich). Mein Atem kondensierte vor meiner Nase, als ich stehenblieb. „Was nun?“, fragte ich mich. Es handelte sich um einen wissenschaftlicher Schatz – Unmengen von Pflanzensorten, von Menschen über Jahrtausende kultiviert, ausgewählt und verfeinert, die meisten wohl schon vor der Katastrophe vom Aussterben bedroht. Deswegen hatte man sie hergebracht. Was sollte ich mit ihnen machen?
Meine geliebte Frau wünscht sich Samen, damit kann ich nun dienen. Welche auch immer sie möchte. Ich könnte mit einem QuadScooter Gläser über Gläser abholen, bei uns an Bord würden wir sie in den Flüssigluft-Räumen besser aufbewahren können als hier. Aber es gab so viele, nicht alle mussten sortenrein sein. Also öffnete ich den ersten der drei Säcke, die ich mitgebracht hatte, und fing an, ohne viel Federlesens Weizenkörner verschiedener Arten, die es in der Form mittlerweile in der freien Natur mehrheitlich vielleicht nicht mehr gab, hineinzuschütten. Als die drei Säcke voll und zugebunden waren, stapelte ich sie auf die Sackkarre und machte mich auf den Rückweg. Motorisiert würde der Transport besser gehen.
Draußen band ich die Sackkarre an das hintere Teil des Fahrrads und zog beides im Tandem nach Hause auf die Hyperborea zurück. Nach fünf weiteren Fahrten mit dem QuadScooter (damit ging es tatsächlich sehr viel einfacher, Foc kam beim Hinterherrennen sehr ins Hecheln, das tut ihm gut, hoffe ich, trotz seines Alters) hielten wir eine Unmenge Getreide und etliche Hundert Gläser mit den verschiedensten Samensorten in den Händen. Eine konsequente Systematik hatte ich in der Dunkelheit nicht eingehalten, das Klassifizierungssystem hatte ich nicht durchschaut. Hätten wir das Getreide zu einem früheren Zeitpunkt unser Eigen nennen können, wären uns die Hühner vielleicht nicht eingegangen. Während ich hin- und herfahre, stapelt meine geliebte Frau unsere Beute in verschiedene Räume, auch in den Kryoräumen mit der Flüssigluft. Als sich die nächste Schlechtwetterfront nähert, fliegen wir über das schwarzblau schäumende Meer davon.
Was machen wir jetzt mit all dem Getreide? Ich glaube, ich werde versuchen, Wodka zu brennen. Unter anderem. Mehl herstellen? Brot sogar? Mit welcher Methode findet man wohl das richtige Mehl für Pasta? Hat es nicht etwas mit dessen Stärkegehalt zu tun? Das kann ich herausfinden, dann habe ich etwas zu tun. Warum nicht. Und darüber hinaus die vielen anderen Samen, was wird meine geliebte Frau nicht alles anbauen können! Ich bin einige Tage sehr gut gelaunt, ich lese wieder ein wenig.
zurück • vor