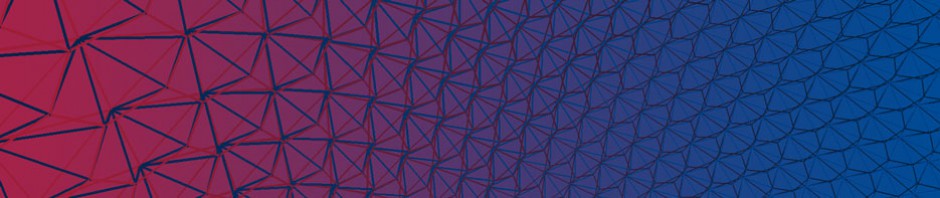Wenig später trafen wir uns, meine geliebte Frau und ich, mit Sven im Schaltschrankraum. Er war beinahe mit der Wartung fertig, die Ventilatoren waren entstaubt und gereinigt, die Kontakte ebenso. Ich erzählte ihm, was Beata durch Nicco gesagt hatte, und bat ihn um seine Meinung.
„Die Veränderungen an meinem Körper sind leicht zu erklären und haben dieselbe Ursache wie bei Beata: Ich habe keine Medikamente mehr. Meine Akromegalie setzt sich fort – meine Knochen wachsen, besonders an den Händen, Füßen und im Gesicht. Ich werde hässlich, meine Gelenke schmerzen. Es ist eine degenerative Krankheit, aber sie betrifft weder das Gehirn noch meine Verhaltensweise und sie ist nicht ansteckend.“
„Akromegalie?“, fragte ich zur Bestätigung. Ich hatte den Namen nie gehört, Sven Maven nickte nur.
„Und welche Medikamente vermisst Beata?“, erkundigte sich meine geliebte Frau.
„Botox.“
Da ging mir ein Licht auf. Natürlich! Deshalb war sie so runzelig geworden!
„Sie ist also alt und wird faltig und verbittert, als Ausgleich wirft sie wüst mit Anschuldigungen um sich. Das passt zu ihr“, setzte meine geliebte Frau nachdenklich nach.
„Was können wir tun, um dein Leiden und deine Beschwerden zu lindern?“, fügte ich hinzu.
„Nichts. Die Medikamente gibt es nicht mehr und die, die sich vielleicht in irgendeinem Krankenhaus finden, sind verfallen. Ich muss damit leben, dass meine Knochen wachsen. Das war mein ganzes Leben lang so, wenn es jemand an Bord nicht akzeptiert, ist es für diese Person bedauerlich, aber man kann nichts dagegen machen. Schade, dass Beata mir ihre Meinung nicht offen ins Gesicht sagt.“
„Wir sagen über die Akromegalie nichts, mach dir keine Sorgen. Beata wird uns nicht spalten. Wir stehen zu dir.“
Klaus kam in diesem Augenblick von der Kommandobrücke zu uns. Sven Maven erzählte ihm, was vorgefallen war.
„Warum hast du uns nicht gesagt, was mit dir los ist?“
„Nun, zum einen hat mich keiner gefragt, zum anderen kann man eh nichts machen. Was gibt es da zu reden?“
„Von wegen, die Menschen sind erwachsen geworden! Schau doch, wie kindisch wir alle geblieben sind, wie neidisch und misstrauisch! Wenn schon schräge Theorien zum Ursprung der Menschheit nötig sind, bleibe ich lieber bei der Wasseraffen-Theorie von Alister Hardy, so wie sie mir Elaine Morgan erklärt hat.“ Klaus regte sich auf, das sah man selten. „Wir haben keine Haare, weil unsere Vorfahren in afrikanischen Tümpeln gelebt haben. Deswegen haben Babys den Reflex, unter Wasser nicht zu atmen, im Gegensatz zu allen anderen Menschenaffen.i Kennt ihr noch das Plattencover von Nirvana mit dem Baby im Schwimmbad? Eine Viertelmillion Generationen seit dem letzten gemeinsamen Vorfahren vom Schimpansen reichen mir für die Unterschiede, die wir heute zwischen Schimpansen und Menschen sehen, dazu brauche ich keine Neotenie.“
„Was ist das für eine Theorie?“, fragte Sven Maven.
„Ach, das stammt aus der Zeit, in der sich die Anthropologen darüber gestritten haben, wie es gekommen sein kann, dass die Menschen so wurden, wie wir sind: haarlos, aufrecht gehend, usw., sie stritten über alles, was merkwürdig an uns ist, bis auf die Intelligenz und die soziale Kohäsion halt. Das haben Anthropologen nämlich nicht als ihr Fachgebiet verstanden, daher überließen sie es anderen Experten. Alister Hardy stellte eine Theorie auf, um all diese menschentypischen Entwicklungen zu erklären, und ich muss sagen, diese Theorie war reizvoll, wenngleich auch mit ziemlicher Sicherheit falsch.“
„Richtig oder falsch, egal. Wenn es eine gute Geschichte ist, verdient sie es, erzählt zu werden“, warf Sven Maven ein.
„Ach, die Details habe ich vergessen… Im Wesentlichen ging es darum, dass Menschen am Körper keine Haare haben, weil unsere Vorfahren im Wasser gelebt haben sollen, in afrikanischen Tümpeln und Seen, nahe am Ufer, vielleicht um Fressfeinden zu entgehen. Auf die Art erklärt sich der Reflex der Kleinkinder, der verhindert, dass sie ertrinken, wenn sie ins Wasser geworfen werden. Eine Zeit lang waren demzufolge Unterwassergeburten en vogue. Diese Protomenschen haben gelernt, aufrecht zu gehen, weil sie auf diese Weise tiefer ins Wasser waten konnten und dennoch Luft bekamen. Klingt mir zu einfach, aber schön. Diese Zeit hat sich angeblich in unser Unterbewusstsein eingebrannt, deswegen lieben es Menschen, an Wasserläufen zu leben. Ufergrundstücke waren stets die teuersten.“
„Dafür fallen mir spontan viele andere Gründe ein“, warf meine geliebte Frau ein. Klaus nickte.
„Mir auch. Ich sage ja, die Theorie klingt gut, aber für meinen Geschmack ist sie vordergründig zu plausibel und auf zu dünne Indizien aufgebaut.“
„Und weiter?“, fragte Sven Maven.
„Überdies ist unser Körperfett anders verteilt als bei Affen üblich. Affenfleisch ist, wenn es Fett ansetzt, marmoriert wie beim Kobe-Rind. In der freien Wildnis aber werden Affen selten fett. Wenn Menschen dick werden, bekommen die eine subkutane Fettschicht, wie sie Wale und Delfine besitzen. Diese isoliert besser vor Kälte als Fell, besonders unter Wasser. Ist aber auch nur ein Indiz.“
„Und was spricht dagegen?“
„Die gewohnte Denkweise und die Tatsache, dass es sich im Wasser gefährlicher lebt als auf dem Land. Im Wasser gibt es mehr Parasiten, es gibt Krokodile und vor allem Nilpferde. Die Urmenschen hätten sehr merkwürdig geschaltet sein müssen, um diese Umwelt der Savanne vorzuziehen.“
„Na egal, lasst uns essen gehen. Das ist so oder so Vergangenheit. Und mit deiner Krankheit und mit Beata und Nicco hat all das nichts zu tun. Ich habe Hunger.“ Und genervt war ich außerdem.
„Dem ist nichts hinzuzufügen“, schloss Sven Maven die Unterhaltung.
In der Tat, da gab es nichts hinzuzufügen. Wir gingen alle vier in die Küche, wo Beata Nalga einen Gemüseauflauf ohne Käse, ohne Béchamel-Sauce und ohne Muskatnuss gebacken hatte. Es schmeckte mir nicht besonders und die Stimmung blieb gedrückt. Wir aßen schweigend, nur manchmal schielte ich auf Beata und wunderte mich, warum ich ihr runzeliges Gesicht nicht früher bemerkt hatte.
Es gibt erblich bedingte Eigenschaften, die nicht der natürlichen Auslese unterworfen sind, weil diese dafür blind ist. Die Evolution blickt ohnehin nicht vorwärts, wie oft naiverweise angenommen wird, sie hat kein Ziel; sie ist das automatisch entstehende Ergebnis der Tatsache, dass Lebewesen am Leben zu bleiben versuchen, bis sie sich im besten Fall erfolgreich vermehren. Auf keinen Fall ist Evolution mit Fortschritt gleichzusetzen, Evolution ist einzig das Ergebnis der Anpassung an Gegebenes und Gegebenes kann sich verändern. Viele Lebewesen evolvieren und werden einfacher, rudimentärer. Insbesondere Parasiten und Viren gehen oft diesen Weg. Wir erleben gerade eine ganz entscheidende Veränderung. Die Evolution blickt in die Welt wie durch einen Rückspiegel, nur die Vergangenheit zählt; die Vergangenheit bestimmt durch die Entscheidungen, die ehemals getroffen wurden, was heute noch möglich ist, und – wie im Rückspiegel –hat sie blinde Flecken. Als Beispiel sei hier das Gen für den erblichen Haarausfall genannt, der matrilinear übertragen wird, jedoch bei den männlichen Nachkommen zum Ausdruck kommt. Damit die Selektion auf dieses Gen einen Einfluss ausüben könnte, müsste der Partner der Frau, die dieses Gen trägt und vererbt, bei seiner Partnerwahl die Möglichkeit berücksichtigen, dass die Brüder der möglichen Partnerin oder, falls die Brüder zu jung sind, um bereits unter manifesten Haarausfall zu leiden, die Brüder der Mutter der möglichen Partnerin (die Schwiegermutter in spe) eine Glatze entwickeln oder nicht. Das macht natürlich kein Schwein (alle Männer sind ja bekanntlich Schweine, aber so weit bringen sie es nicht). Bei der Evolution spielt Zufall eine wesentliche Rolle, damit muss man sich abfinden. Glück muss man dabei haben.
Bei Infektionen auch. Meine geliebte Frau und ich unterhielten uns diese Nacht weiter in ihrer Kabine (wir besaßen jeder eine eigene, es waren genug da, aber wir teilten oft ihre, die war aufgeräumter als meine). Sie hatte sich Gedanken über Niccos Theorie gemacht, schließlich selbige verworfen und stattdessen vieles über Parasiten in Erfahrung gebracht, was im Speicher Deep Doubts ruhte. Parasiten sind faszinierende Geschöpfe, so viel ist sicher.
„Was Parasiten mit ihren unfreiwilligen Wirten anzustellen in der Lage sind, grenzt an Magie“, fing meine geliebte Frau ihre Darstellung an. „Sie sind unsympathisch, natürlich. Nach unserer Wertvorstellung leben sie auf Kosten der anderen, das erachten wir als unfair. Aber biologisch betrachtet ist es sehr interessant zu sehen, was manche Tiere anstellen, um auf oder in dem Körper anderer Tiere zu überleben. Besonders spannend nachzuvollziehen ist, wie sie sich innerhalb eines Tieres vermehren und wie sie es dann schaffen, dass ihre Nachkommen ebenfalls einen Wirt finden. Manche Parasiten brauchen mehrere Zwischenwirte, manche leben zum Beispiel zunächst im Wasser, später in einer Pflanze, abschließend in einem Vogel oder Säugetier. Ausgerechnet die Tatsache, dass Parasiten oft mehrere Wirte hintereinander benötigen, um ihren Lebenszyklus zu vollbringen, wird von manchen Wissenschaftlern benutzt, um die Gesundheit eines Ökosystems einzuschätzen: Je mehr Parasiten ein Ökosystem verträgt, desto gesünder soll es sein.“
„Alles eine Frage des Blickwinkels“, ergänzte ich. „Alle Lebewesen leben im Endeffekt auf Kosten anderer, mit Ausnahme der Pflanzen. Wir sind jetzt Nekroparasiten, aber auch ein Löwe ist in gewissem Sinne ein Parasit der Gazellen. Er frisst sie auf, wenn er sie fängt.“
„Alles eine Frage des Blickwinkels, in der Tat. Nicht nur wir Menschen sind Parasiten der Welt, alle höheren Wesen sind letztendlich Parasiten der Sauerstoff erzeugenden Bakterien und natürlich der Pflanzen die sich vor Äonen diese Bakterien als Chloroplasten aneigneten. Die absolute Ausbeutung – die befallenen Wesen werden im eigenen Körper gefangen gehalten. Aber vielleicht sehen es die Chloroplasten anders. Vielleicht denken sie, dass sie die Pflanzen als Parasiten übernommen haben, Wesen, die ihnen die meiste Arbeit abnehmen, sie gut geschützt innerhalb der Zellen – aller ihrer Zellen! – dermaßen rundum versorgen, dass sie im Laufe ihrer Evolution auf die meisten eigenen Gene verzichten konnten, selbst auf ihren Kern, falls sie jemals einen hatten. Die Arbeit übernahmen die Wirte. Sie mussten sich nur am CO2 laben, der ihnen zugeführt wurde – ihre einzige und liebste Mahlzeit, ihr einziges Bedürfnis, ein Molekül, das sie mit Hilfe des Sonnenlichts (oder eines ähnlichen Lichtes der richtigen Wellenlänge und Intensität, wie z. B. dem der Lampen in den Gewächszimmern) in Kohlenstoff und Sauerstoff spalteten. Von diesem Sauerstoff, der wir atmen, und diesem Kohlenstoff, den wir essen, sind wir alle abhängig, in dem Sinne also Parasiten. Was können die Chloroplasten gegen diesen Angriff unternehmen, der in der Regel bedeutete, dass sie zusammen mit dem Teil der Pflanze, in dem sie lebten, gefressen wurden oder von der Pflanze zunächst ausgenutzt und dann abgestoßen, wie bei Baumblättern im Herbst? Zum einen vermehrten sie sich rasend schnell, zum anderen existieren sie im Innersten einer jeden Zelle einer jeden Pflanze; neben dem Erbgut, in jedem Samen. Jedesmal, wenn sich die Pflanze vermehrt oder ihre Zellen sich teilen, vermehren sich die Chloroplasten mit; die Pflanze braucht sie, kann sie jedoch nicht selber herstellen. Sie muss ihre Vermehrung, so gut es geht, innerhalb einer bestimmten Grenze in Schach halten, aber sie kann sie nicht konsequent bekämpfen. Deswegen wird es Chloroplasten geben, so lange es auf diesen Planeten Leben geben wird. Die höheren Tiere können sich niemals so schnell vermehren, daher gab es immer verhältnismäßig wenige davon. Je komplexer die Tiere, umso weniger schnell können sie wachsen, ihr Stoffwechsel kann nicht gleichzeitig in der Komplexität und in der Geschwindigkeit wachsen.“
Mir fiel dazu ein: „Mit unserer Gesellschaft hatten wir Menschen diese Regel verletzt. Wir waren zu viele, wir waren allgegenwärtig, wir veränderten unsere Umwelt zu schnell (und uns mit ihr, daher merkten wir es lange Zeit nicht, fürchte ich).“ Und jetzt macht sich meine geliebte Frau Sorgen, wir könnten unsererseits Opfer von Parasiten werden. „Jenseits derjenigen, die wir schon intus haben“, erwidere ich. „Das sind Symbionten, hoffe ich“, sagte meine geliebte Frau dazu. Sie hätte sie gleich so nennen können, das klingt gleich viel freundlicher. Sie redete weiter:
„Nun fürchte ich, dass ein Parasit den Menschen unter seine Kontrolle gebracht und dadurch zu Handlungen gezwungen hat, die unsere soziale Ordnung, unsere Zivilisation letztendlich, ausgehebelt haben. Die Folgen sehen wir: Mord und Totschlag.“
„Und welche Rolle spielt dabei die Grippe?“
„Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Hypothese. Vielleicht hat die Grippe unser Immunsystem geschwächt und die Parasiten konnten sich ausbreiten. Eventuell haben die Parasiten unser Immunsystem geschwächt und die Grippe ist nur eine Begleiterscheinung. Möglicherweise fördert die Grippe die Ausbreitung des Parasiten. Vielleicht fördern aber andersherum auch die Parasiten die Ausbreitung der Grippe. Es kann sogar sein, dass ich völlig falsch liege. Es kommt mir allerdings als Arbeitshypothese fruchtbarer vor als die Progenese, die Neotenie oder wie auch immer die Phänomene hießen, die Nicco so mühsam von Beata gelernt hat.“
„Und ein einfacher Parasit soll in der Lage sein, unser Verhalten derartig zu steuern?“
„Oh ja, das schaffen Parasiten immer wieder. Ich habe einige Beispiele im iTempt™ gespeichert, warte mal einen Augenblick…!“ Meine geliebte Frau tippte einige Male auf ihr Display, es kamen verschiedene Dokumente zum Vorschein. „Hier, die arme Ameise. Es gibt einen Saugwurm, Dicrocoelium dendriticum, zu Deutsch der Kleine Leberegel, der beginnt sein Leben als Schneckenparasit. Die winzigen Wimpernlarven in den Eiern werden von Schnecken mit ihrer normalen Pflanzennahrung unbemerkt gefressen und vermehren sich in deren Darm über zwei Sporocysten-Phasen, bis sie sich zu Zerkarien entwickeln. Als Wirte kommen an die hundert Schneckenspezies in Betracht. Die Zerkarien wandern schließlich die Atemwege der Schnecke hoch, verursachen dort eine Reizung, die die Schnecke dazu veranlasst, sie in Form kleiner Schleimkügelchen auszuwürgen. Der Leberegel ist also bereits in dieser Phase seiner Entwicklung in der Lage, eine Schnecke im richtigen Augenblick zum Husten zu bringen. Nebenbei kastriert er die Schnecke, das scheint dem Egel zu helfen. Die Schleimkügelchen sind zum Bersten voll mit bis zu 400 infektiösen Zerkarien und werden von Ameisen als Delikatessen verschlungen. Dadurch wiederum infizieren sich die Ameisen und es kommt zur zweiten Manipulation. Nach einiger Zeit, wenn die Zerkarien gereift sind, die meisten befinden sich in der Leibeshöhle der Ameise, wandern eine oder zwei ins Unterschlundganglion, wo sie einen direkten Einfluss auf das Nervensystem der Ameise ausüben. Wenn die Temperatur unter 15 °C fällt, bringen sie die Ameise dazu, einen Grashalm oder eine Blüte hinaufzukriechen, und lösen oben, an der Spitze der Pflanze angekommen – dort, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflanze von einem Pflanzenfresser gefressen wird, am größten ist –, einen Krampf an den Kauwerkzeugen der Ameise, einen Mandibelkrampf, aus. Durch diese zweite Verhaltensmanipulation maximieren die Egel ihre Chance, in den erwünschten Endwirt zu gelangen. Meistens handelt es sich hier um Pflanzenfresser, sie wurden bei vielen Arten nachgewiesen, aber ebenso bei Katzen, Vögeln, Hunden, selbst beim Menschen wurde der Kleine Leberegel festgestellt. Beim Endwirt wandert der Egel in die Galle, wo er Dicrocoeliose verursacht und sich bis zu sechs Jahre lang vermehren kann. Seine Eier werden mit dem Gallenfluss in den Verdauungstrakt entleert und letztendlich ausgeschieden, um dann vielleicht wieder von einer Schnecke gefressen zu werden – und der Zyklus beginnt von vorn.“ii
„Widerlich und irgendwie beeindruckend.“
„Wieso widerlich? Der Egel will nur überleben!“ Meine geliebte Frau blätterte wieder in ihrem iTempt™. „Hier, das betrifft uns Menschen: Der Medinawurm Dracunculus medinensis verursacht bei uns und vielen anderen Säugetieren die Dracontiasis. Die Larven des Medinawurms befallen winzige Krebse, die im Wasser leben, zumeist in Afrika. In der Trockenperiode ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Krebse vom Menschen beim Trinken mitaufgenommen werden, somit landen sie im Dünndarm, von wo aus sie sich in die Bauch- und Brustmuskulatur bohren. Dort paaren sie sich, die kleinen Männchen sterben und werden eingekapselt, die Weibchen hingegen wachsen bis zu einem Meter Länge und wandern durch den befallenen Körper meistens in Richtung der unteren Extremitäten. Die Weibchen setzen sich im Bindegewebe der Füße oder der Unterschenkel fest, während die Eier in ihrem Inneren reifen. Ein Jahr nach Aufnahme der Larve sind die Eier reif und der Medinawurm manipuliert seinen Wirt, damit die Eier ins Wasser gelangen. War der Wurm bisher unsichtbar für die menschliche Immunabwehr, so verursacht die nahende Eiablage einen stark brennenden Juckreiz, der sich am besten mit Wasser lindern lässt. Sobald Kontakt zum Wasser hergestellt ist, durchbricht der Medinawurm die Haut seines Wirtes und entlässt Tausende von Eiern ins Wasser, wo diese sich sofort auf die Suche nach einem Krebs machen, um diesen seinerseits zu befallen. Die Eiablage kann mehrere Wochen andauern, am Ende stirbt der Wurm und der Wirt behält eine eitrige Wunde zurück. Der einfache Medinawurm kann Menschen dazu bringen, dass sie ihm oder besser ihr, denn es handelt sich immer um die Weibchen, die Eiablage im Wasser ermöglichen.“iii
„Ist das nicht dieser Wurm, den man mit einem kleinen Stab vorsichtig aus der Haut ziehen kann, indem man ihn aufrollt?“
„Ja, so kann man den Medinawurm entfernen, das ist seit Urzeiten bekannt. Manche Personen behaupten sogar, dass der Äskulapstab, das Symbol der Medizin, eine Schlange um einen Stab gewickelt, auf den Medinawurm zurückgeht. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass das nicht stimmt.“ Jetzt lächelte meine geliebte Frau.
„Hast du mehr solcher Geschichten auf Lager?“
„So viele du willst. Dieses Verhalten ist in der Natur die Regel, nur wir von der Zivilisation geschädigten Wesen glaubten, Parasiten seien primitiv, dumpf, ekelhaft. Die meisten von ihnen sind jedoch hochgradig spezialisiert und haben sich auf ein Minimum zurückentwickelt, was bei der Übertragung unabdingbar ist; sie haben unglaubliche Überlebensmechanismen entwickelt. Hier, das betrifft uns beide direkt: Toxoplasma gondii, der Erreger der Toxoplasmose. Die Zwischenwirte des Toxoplasma sind Ratten, die Endwirte Katzen. Nahezu alle Menschen, die Katzen halten, sind mit Toxoplasma gondii infiziert, was augenscheinlich keine Auswirkungen auf uns zu haben scheint. Ratten haben ihrerseits große Angst vor Katzengeruch, schon deren Urin macht sie närrisch. Es sei denn, sie sind Träger des Toxoplama gondii – in dem Fall versetzt sie der Geruch von Katzenurin nicht mehr in Panik, was sicher einiges dazu beiträgt, dass mehr infizierte Ratten von Katzen gefressen werden. Das ist im Sinne des Parasiten. Wenn Menschen hingegen Toxoplasmose infiziert sind, bleiben sie meist symptomfrei, wenn ihr Immunsystem in Ordnung ist. Das bedeutet das Ende für den Parasiten, seine Chancen, in eine Katze zu gelangen, sinken rapide. Man hat aber nachgewiesen, dass Toxoplasma gondii dennoch unser Verhalten beeinflusst. Infizierte Männer haben die Neigung, Normen und Regeln nicht mehr so genau einhalten zu wollen, sie werden misstrauischer, verlieren gleichzeitig die Furcht vor Bestrafung. Frauen hingegen werden warmherziger und unternehmungslustiger. Beide Verhaltensänderungen reichen nicht aus, um die Wirte in katzenhaftige Mahlzeiten zu verwandeln, aber eine Manipulation ist es dennoch.“iv
„Toxoplasma gondii ist ein Protozoon, nicht wahr?“
„Ja, wie die Malaria-Erreger, mit denen sie verwandt sein sollen.“ Mir kamen meine Mücken in den Sinn, die ich ausrotten wollte, um die Übertragung des Plasmodium falciparum und anderer Malariaerreger zu unterbinden.
„Wow!“, sagte ich nur noch von der Vorlesung erschöpft. Es war Zeit, ins Bett zu gehen. Wir würden sicher noch genügend Zeit haben, uns über Parasiten, Manipulation, Verhaltensänderungen und Zwang den Kopf zu zerbrechen.
zurück • vor