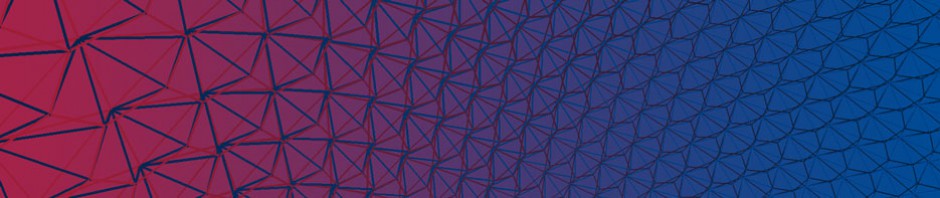Quis Custodiet Ipsos Custodesi.
Juvenal (~128 nach J.C.)
Die Wüste Kiro befindet sich auf dem Gelände, auf dem sich früher der Flughafen Tempelhof befand, und wird von den Berlinern so genannt, weil seit der Schließung des denkmalgeschützten Flughafens vor mittlerweile neunzehn Jahren dessen Gelände nichts mehr gewachsen ist außer Unkraut. Das liegt zum einen an einem erbitterten Rechtsstreit mit der Türkei, die als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches auftritt, und zum anderen daran, dass kein liquider Investor ernsthaftes Interesse am Erwerb des Grundstücks gezeigt hat. Dieses vermeintliche Desinteresse ist ein schlechtes Zeichen für Berlins Anziehungskraft als Industriestandort, bietet uns als expansionswilliges Unternehmen andererseits eine ungewöhnliche Chance dar.
Während dieser neunzehn Jahre seit der Einstellung des Flugbetriebs hat nur der dicke Bernd, ein Berliner Original aus Bremen, Schafe auf die Weide zwischen den Rollfeldern geführt, mehr gab das Gelände nicht her. Die zwei Pisten zeigen deutlich die Spuren des winterlichen Frostes, die Gebäude und Hangars rosten ungepflegt vor sich hin. Nur ab und zu stört ein Marketing-Event die Ruhe, zum Beispiel die Vorstellung eines neuen Automodells. Die Fachjournalisten fahren dann auf der weiten Fläche die Autos aus, toben sich in dem hindernisfreien Gelände aus und achten kaum auf das, was früher der schönste Flughafen der Welt war.
Die Türkei liegt im Rechtsstreit mit dem Berliner Senat, weil sich auf einem guten Drittel des ehemaligen Flughafengeländes früher ein türkischer Friedhof befand. Diesen Friedhof schenkte König Friedrich Wilhelm III. den türkischen Angehörigen der Königlich Preußischen Armee. Der erste Leichnam, der auf dem Areal begraben wurde, war der des Dichters Ali Aziz Efendi im Jahr 1798. In den Jahren danach wurden türkische Politiker, Wissenschaftler, Geistliche, ein Botschafter, eine Prinzessin und sogar ein Freiheitskämpfer dort begraben nebst zahlreichen „gewöhnlichen“ türkischen Bürgern. Im Jahr 1866 musste der Friedhof um einige hundert Meter verlegt werden, um Platz für den Bau einer Kaserne zu machen, womit die Ansprüche auf das Grundstück nach Meinung des Klägers, der Türkischen Islamischen Republik, zusätzlich gefestigt wurden. Der Flughafen Tempelhof wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwar erweitert und überdeckt seitdem einen Teil des alten Friedhofs, aber eine derartige Nutzung war zu jener Zeit nur dank des Alliiertenrechts möglich. Die Alliierten, allen voran die USA, haben die Flughafenerweiterung genehmigt, aber wenn der Flughafen seine Bestimmung ändert (was nach Meinung der türkischen Juristen spätestens Ende Oktober des Jahres 2008 mit der endgültigen Einstellung des Flugbetriebs und der gleichzeitigen Schließung des Flughafens der Fall war), steht der Friedhof wieder der Türkei zu. Um dementsprechend auf der Wüste Kiro unsere größeren Luftjachten bauen zu können, würden wir uns mit unseren türkischen Mitbürgern unterhalten müssen.
Den Berliner Senat dazu zu bewegen, uns das Gelände, die alten Hangars, die Hallen und die Büroräume zu vermieten, sollte hingegen nicht wirkliche schwer werden: Eine kleine Bestechung würde reichen, um die Brache zum neuen Leben erwecken zu dürfen. Die Bestechung fiel bescheiden aus, die Verantwortlichen freuten sich, das Thema endlich los zu sein: ein wenig Geld unter der Hand für die Verkehrssenatorin, Frau Esmegma Praeputschka, eine Spende für ihre Partei und das Versprechen unsererseits, der Stadt eine Mischung aus Kunstprojekt, didaktischer Museumsinstallation und Straßenbeleuchtung zu schenken und auf unsere Kosten für deren Betrieb zu sorgenii. Des Weiteren möchte die Partei der Senatorin unsere mittelgroßen Luftjachten für Wahlkampfwerbung nutzen dürfen, sobald die ersten Exemplare flügge würden. Da diese Idee gleichzeitig Werbung für unsere Produkte bedeuten würde, inklusive der damit einhergehenden Überfluggenehmigung für das Stadtgebiet (Parteiwerbung ergibt schließlich nur dort wirklich Sinn, wo viele Menschen zuschauen, nicht auf dem platten Land), betrachtete ich diese Bestechung als sehr günstig für uns. Der Wirtschaftssenator, Seine Excellenz Herr Ismaelit Sarracuda, wollte ebenfalls die Hand aufhalten, natürlich, und seine Partei sollte auch nicht zu kurz kommen – das konnten wir uns leisten.
Den Türken hingegen mussten wir etwas Handfesteres und weniger Vandalismusanfälliges als ein Kunstprojekt anbieten – hier erwies sich unser Junger Hiwi, Ali Ben Otrefuah, derjenige, der damals als Einziger den Aufstieg des ersten Vendobionten fotografiert hatte, als unerwarteter Kontakt. Ali war kein Türke, seine Familie stammte aus Algerien, wo sein Großvater gegen die Franzosen gekämpft hatte (daher sein Name, ursprünglich der nom de guerre, den er von den verärgerten Franzosen bekommen hatte, weil er sie angeblich ein ums andere Mal angegriffen hatte, auf Französisch eben „une autre fois et ancore une autre fois“ – so jedenfalls erzählte es Ali). Irgendwann waren die Franzosen aus Algerien vertrieben worden, daraufhin emigrierte Alis Vater zunächst in die Schweiz, später kam er nach Berlin, wo schließlich Ali zur Welt kam und aufwuchs.
Ich verabredete mich zusammen mit meiner geliebten Frau im Café Morgenland mit den Türken direkt am Theo-van-Gogh-Platz, dort, wo die Manteuffelstraße von Paul-Lincke-Ufer kommend auf die Skalitzer Straße stößt, im Schatten einer riesigen Platane gegenüber der Moschee. Uns gegenüber saßen zwei Herren in teuren Anzügen und billigen Hemden, mit Gel in den Haaren. Einer der beiden spielte mit etwas, was in meinen Augen wie ein Rosenkranz aussah, was er selber sicher nicht so bezeichnete. Ali saß am Rande und hörte und schaute zu. Wir tranken Kaffee und erläuterten unsere Baupläne am Flughafen. Die Türken unterbrachen uns nicht, wechselten manchmal ein Wort auf Türkisch, was wir natürlich nicht verstanden (Ali spricht kein Türkisch und nur rudimentär Arabisch) und nickten uns regelmäßig und wohlerzogen zu. Als wir uns am Ende verabschiedeten, hatte ich nicht den Eindruck, große Fortschritte erzielt zu haben, aber das war beim ersten Treffen kaum zu erwarten gewesen. Unsere Gesprächspartner waren nicht befugt, selbstständig Entscheidungen zu treffen, wie wir später bemerkten – sie waren nur vorgeschoben worden. Von wem, erfuhren wir nicht, aber wir bekamen zwei Tage später eine Antwort: Sie waren unter bestimmten Bedingungen einverstanden. Diese Bedingungen waren nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte.
Zum Glück wollten die Türken keinen Anteil an unserem Unternehmen, da waren sie anders gestrickt als die große InTschuRanz. Ich hätte mich auch geweigert. Sie wollten unsere Schiffe, um Leichenrückführungen in die Türkei anzubieten. Bei einer jährlichen Sterblichkeitsrate von etwa 10 pro 1.000 Einwohnern und einer halben Million Türken in Berlin war das eine einleuchtende Geschäftsidee, besonders, wenn die Muftis, Imame oder wie die zuständigen Geistlichen bei ihnen hießen, Geld zuschießen sollten. Sie verlangten einen direkten Zugang von der Moschee an der Hasenheide neben dem Flughafen zum Flughafengelände. Sie wollten ihre Luftjachten grün gestrichen haben (was mit den Grätzel-Zellen nicht sinnvoll zu bewerkstelligen schien). Sie beanspruchten die Luftschiffe beinahe für umsonst (darüber sollte noch zu reden sein; letztendlich einigten wir uns darauf, das erste Luftschiff umsonst zur Probe bereitzustellen, die weiteren jedoch sollten sie regulär bezahlen). Und sie signalisierten Eile. Dabei hatten wir noch nicht ein einziges großes Luftschiff gebaut! Am eiligsten indes hatten wir es: Praktisch alle wichtigen Komponenten hatten wir ja bereits an den Vendobionten ausprobiert, die Konstruktionspläne waren fertig, die Produktionspläne lagen in der Schublade, detailliert ausgearbeitet. Als ich unseren jungen Hiwi durch unsere alten Hallen gehen sah, war ich geneigt, ihm den Ehrentitel des Padawan zu verleihen, aber er wollte lieber Scheich El-Rais genannt werden. Ich machte ihn die Freude und dachte für mich: Allah ist groß – Ali ist der Größte. Ich hätte damals, als er zum ersten Mal mit seiner Kamera bei uns auftauchte, bei der Lufttaufe des ersten Vendobionten, nicht gedacht, dass er uns je einen so wichtigen Kontakt würde vermitteln können. Umso mehr freute ich mich jetzt.