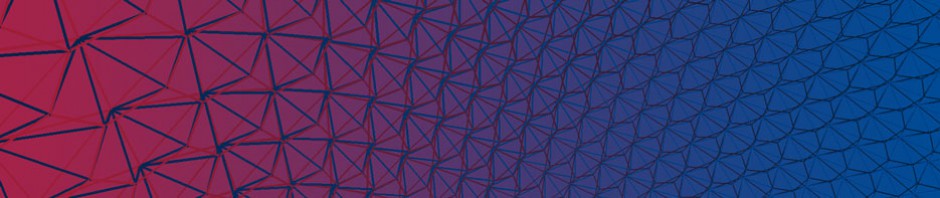Die holografischen Datenspeicher der Hyperborea, auch Holospeicher oder H-Speicher genannt, sind enorm groß und enthalten eine Fülle an Material, die uns beide, meine geliebte Frau und mich, überfordert. Unseren Zentralcomputer, der diese riesigen Speicher verwaltet und sortiert, nennen wir stolz Deep Doubt, er enthält eine Spiegelung aller Netzseiten, die unser Unternehmen jemals besucht hat, und viele Daten, die wir sorgfältig gekauft und zusammengetragen haben. Unser ursprünglicher Deep Doubt war fest im Flughafen Tempelhof installiert: Mit ihm und von dort aus steuerten wir unsere Firma, unsere Daten, unsere Kundenbeziehungen. Als wir mit der Hyperborea endgültig aufbrechen mussten, spiegelte meine geliebte Frau im letzten Augenblick alle unsere Daten auf den Rechner an Bord. Das dauerte nicht so lange, wie ich befürchtet hatte und erwies sich als ausgezeichnete Idee. Der Zwillingsrechner wurde zu einem zweiten Deep Doubt – er enthielt die gleichen Daten, er war somit virtuell, da sich digitale Kopien nicht vom Original unterscheiden, derselbe Rechner. Daten ohne Ende. Früher, als wir noch jung waren, wurde die Leistungsgrenze der Computer von der Hardware und den Speichermöglichkeiten vorgegeben. Heute bestimmt die Software die Grenzen, unsere sowieso. Die Holospeicher sehen aus wie Zuckerwürfel, aus denen eine Unzahl dünnster Kabel herausragen. Vermutlich ist das der Grund, weshalb Computerfachmänner diese Bausteine früher hairy sugarcubes oder Haikus nannten. Viele dieser Computerexperten haben, ähnlich wie meine geliebte Frau, eine Affinität zu Fernöstlichem. Bei uns sind diese Kabel aus Gold, das entsprach dem höchsten Qualitätsstandard. Billiger ging es mit Silber oder Kupfer. In einem Würfel ließen sich mehrere Dutzend Terabyte speichern, Deep Doubt hatte einschließlich der Sicherheitskopien Zugriff auf mehrere Zehntausend kompakt angeordnete Speicherwürfel. Wir haben darin viele Bildsequenzen gespeichert, die wir mit Hilfe der Augen und der Vendobionten selbst aufgenommen haben und immer noch aufnehmen, viele Daten, Bücher, Handbücher und eine Unzahl an Langspielfilmen. Fernsehserien und Sportübertragungen sind gleichermaßen dabei, aber die schauen wir seltener an, es sind Sendungen, die ohne Aktualität viel von ihrem Reiz verloren haben. Musikvideos gehören ebenso zu unserem Fundus. Die Filme haben mich erstaunt: Es sind über vierzigtausend, von ihnen sind allerdings nur an die neunhundert – laut Kritiken und Rezensionen –sehenswert. Filme werden seit knapp über einem Jahrhundert gedreht und es gab wenige Jahre, in denen mehr als zehn wirklich gute Filme entstanden sind. Wenn man jeden Tag einen Film ansieht, hat man nach zwei Jahren das Wesentliche durch. Ich verstehe jetzt, warum die Fernsehanstalten früher derart viel Müll gezeigt haben: Es gab zu wenig gutes Material. Bei Büchern war die Lage anders: Wir hatten über hundert Millionen Schriften gespeichert. Wie viele davon wirklich Bücher waren, kann lange diskutiert werden; da alles digital gespeichert ist, lässt sich das, was ein Buch ist und was nicht, nicht sauber trennen. Selbst nach der restriktivsten Definition verfügten wir über mehrere Dutzend Millionen. Viele waren als Faksimile als Bilddatei gespeichert, einschließlich vieler Inkunabeln. So bibliophil bin ich doch geblieben. Darüber hinaus besaßen wir Kopien unzähliger Zeitschriften, Zeitungen, überdies Pamphlete, Flugblätter, Skizzen, Patentschriften, technische Gebrauchsanweisungen, selbst einige, die völlig unverständlich übersetzt waren. Überhaupt die Übersetzungen: Wir hatten viele Schriften, die Mehrheit sogar, in Sprachen gespeichert, die wir nicht verstanden. Ich hob sie dennoch auf und das nicht nur, weil meistens die Übersetzungen des iTempt™ doch leidlich verständlich waren. Das wäre zu utilitaristisch gedacht und ich benutzte die Übersetzungsfunktion nur selten. Darauf war mein Kontakt zur Menschheit – meine Erinnerung – geschrumpft. Bei dieser Materialfülle ergab sich nur das Problem der Indexierung: Wie findet man etwas Bestimmtes? Früher haben viele Angestellte und Freiwillige alles nach Stichworten katalogisiert, heute müssen wir auf die automatisch erstellten Suchalgorithmen vertrauen. Die sind gar nicht so schlecht, aber Menschen waren einfallsreicher – sie kamen auf mehr sinnvolle oder interessante Assoziationen. Manchmal sucht man ein Werk lange und man weiß nie, ob man etwas nicht findet, weil man falsch sucht, oder ob wir das Gesuchte einfach nicht besitzen. Meine geliebte Frau kann mit dem System viel besser umgehen als ich, häufig muss sie mir helfen. Wenn nicht einmal das klappt, ist es einfacher, auf das Gesuchte zu verzichten und sich eine Alternative auszudenken. Das schont die Nerven.
Es lohnt sich dennoch nicht, das Überflüssige zu löschen. Eine solche selektive Löschaktion würde mehr Mühe und Energie verbrauchen, als die Daten einfach aufzubewahren: Man müsste nicht nur ganz präzise entscheiden, was überflüssig ist, man müsste es zudem gezielt löschen. Und man weiß ja nie, vielleicht kann man gerade diese Daten eines Tages doch noch gebrauchen…
zurück • vor